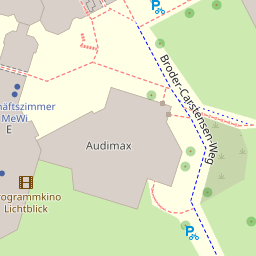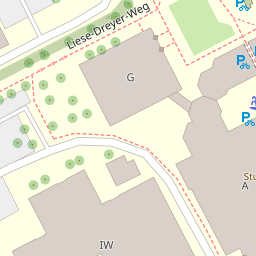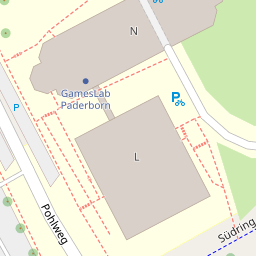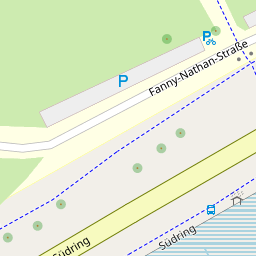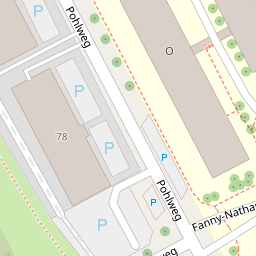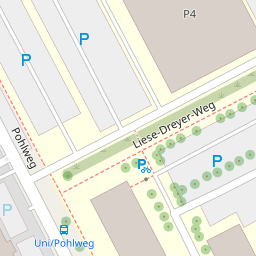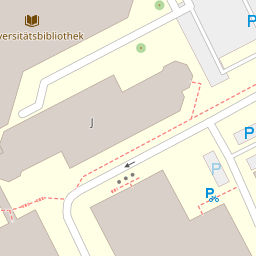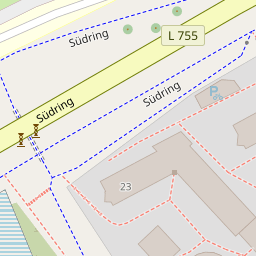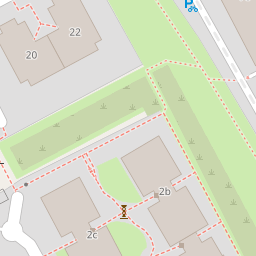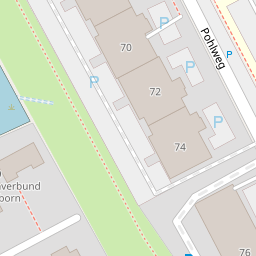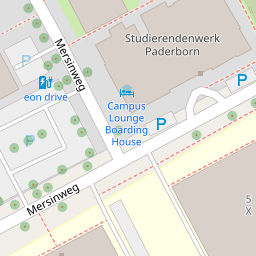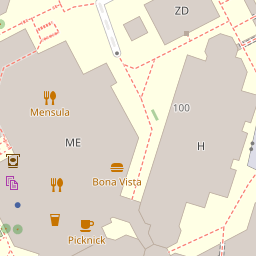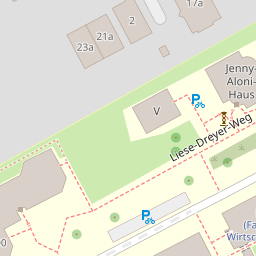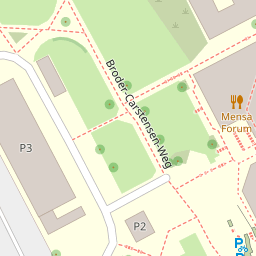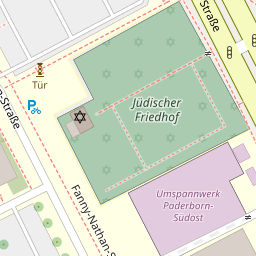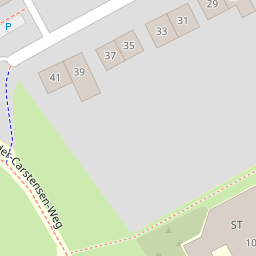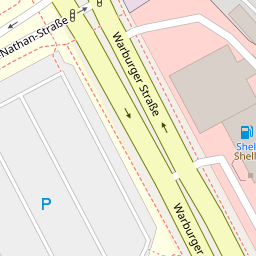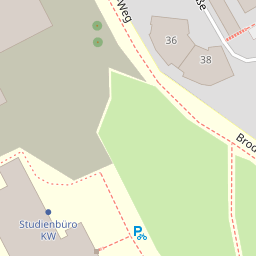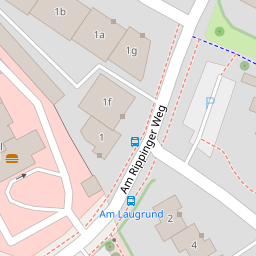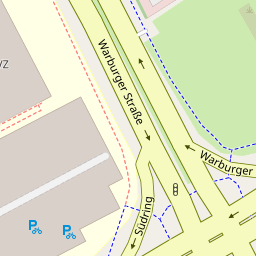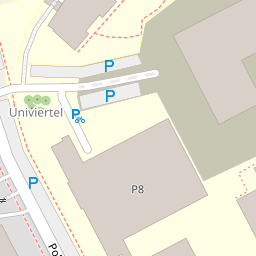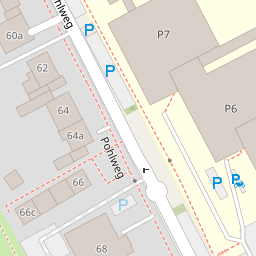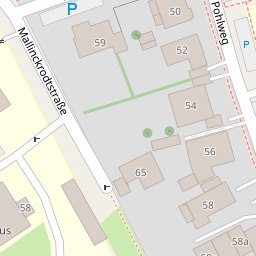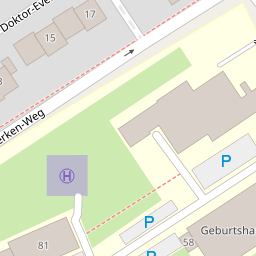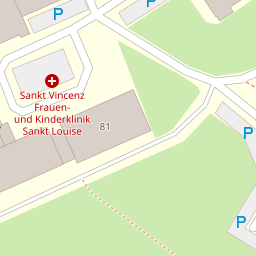Genderportal
Der Begriff Bisexualität wurde über die Zeit unterschiedlich verwendet. Beschrieb er einst etwa ein biologisches Konzept, mit dem das Vorhandensein von männlichen wie weiblichen Geschlechtsmerkmalen innerhalb einer Person bzw. eines Lebewesens benannt wird,
- das gleichzeitige Vorhandensein männlicher wie weiblicher psychischer Geschlechtsmerkmale und auch
- eine sexuelle Neigung, die sich auf ,beide‘ Geschlechter bezieht (vgl. ebd.: 41), wird der Begriff im öffentlichen Diskurs heutzutage vor allem in dieser dritten Form verwendet. (Uttendörfer 2002)
Bereits Freud „wies der Bisexualität als bio-psychologischem Phänomen eine zentrale Rolle zu” und zweifelte durch seine Überlegungen die heterosexuelle Norm an (ebd.). Demnach gibt es nicht nur zwei Geschlechter, das psychische Geschlecht ist nicht zwangsläufig identisch mit dem ,Körpergeschlecht‘ einer Person und es gibt nicht rein heterosexuelles Begehren. Heutzutage bestehen verschiedene Konzeptionen von Bisexualität nebeneinander. Es handelt sich um eine die Rechtsordnung hinterfragende, „,fließende‘ Kategorie”, die sich der Ansicht verweigert, „die eigene Identität aus der Sexualität abzuleiten.” (ebd.) Darüber hinaus stellt Bisexualität - wenn auch von verschiedenen Seiten, insbesondere in den 1970er Jahren immer wieder kontrovers diskutiert - die Binarität von Homo- und Heterosexualität, männlicher und weiblicher Geschlechtsidentität und damit jedes heteronormative Denken radikal infrage.
(Weiterführende) Literatur:
Fritzsche, Bettina (2007): Das Begehren das nicht eins ist. Fallstricke beim Reden über Bisexualität. In: Hartmann, Jutta et al. Hg.) Heteronormativität. Wiesbaden: Springer. S. 115-131.
Ritter, Kim/Voß, Heinz-Jürgen (2019): Being Bi. Bisexualität zwischen Unsichtbarkeit und Chic. Göttingen: Wallstein.
Uttendörfer, Karin: Bisexualität. In: Metzler Lexikon Gender Studies / Geschlechterforschung. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Hrsg. von Knoll, Renate. Stuttgart: J. B. Metzler 2002, S. 41.
Chancengleichheit beschreibt den sozialpolitischen Leitgedanken, dass alle Bürger*innen einer Gesellschaft unabhängig von Faktoren wie etwa ihrer sozialen Herkunft, Geschlechtszugehörigkeit, ethnischen Zugehörigkeit, Behinderung und weiteren Faktoren die gleichen Zugangsbedingungen – zum Beispiel zu Bildungsinstitutionen – und gleiche gesellschaftliche Teilhabechancen haben. Dabei muss zwischen formaler und substanzieller Chancengleichheit unterschieden werden:
- Formale Chancengleichheit hat das Ziel, grundsätzlich gleiche Ausgangsbedingungen für alle Menschen zu schaffen – bspw. durch einen formalisierten Zugang zu Berufsausbildungen und Hochschulen, der in eindeutig definierten Zugangsvoraussetzungen wie der Allgemeinen Hochschulreife besteht. Bei der formalen Chancengleichheit werden allerdings weder die Gründe analysiert, warum bestimmte Personen(-gruppen) Zugangsvoraussetzungen (nicht) erfüllen können, noch steht dahinter der Anspruch, dass entsprechende Strategien zu einem „wirklichen“ Erfolg führen.
- Letzteres ist das Ziel substanzieller Chancengleichheit, die eine Gleichverteilung der Möglichkeiten auf gesellschaftlichen Erfolg für alle Mitglieder einer Gesellschaft unabhängig von Merkmalen wie bspw. Geschlecht oder Ethnizität einfordert. Es geht entsprechend nicht ausschließlich darum, gleiche Ausgangsbedingungen zu schaffen sowie Zugangsbarrieren aufzuheben. Substanzielle Chancengleichheit ist demnach bspw. erst dann erreicht, wenn Frauen trotz vergleichbarer Qualifikation nicht mehr am Zugang zu Führungspositionen gehindert werden (siehe Eintrag Gläserne Decke). Ein Mittel zum Erzielen substanzieller Chancengleichheit stellt – sofern bisherige Maßnahmen nicht erfolgreich waren – dementsprechend die Einführung von Quoten, wie etwa der Frauenquote (siehe Eintrag Frauenquote), dar.
(Weiterführende) Literatur:
Hopf, Wulf/ Edelstein, Benjamin (2018): Chancengleichheit zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Verfügbar unter: Chancengleichheit zwischen Anspruch und Wirklichkeit | bpb.de. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Sorger, Claudia (2014): Wer dreht an der Uhr? Geschlechtergerechtigkeit und gewerkschaftliche Arbeitszeitpolitik. Münster: Westfälisches Dampfboot. (Aufarbeitung der Theoriediskussion zu den Begriffen „Gleichheit“ und „Geschlechtergerechtigkeit“)
Aus einer soziologischen Perspektive dient der Begriff Diversität oder auch Diversity (engl.) zur Beschreibung der Vielfalt von Menschen bzw. Gruppen, die sowohl gruppenspezifische wie individuelle Unterscheidungsmerkmale umfasst. In der Regel werden unter Diversität Merkmale wie ethnische Zugehörigkeit, soziale Herkunft, Geschlechtszugehörigkeit, sexuelle Identität, aber auch Behinderung, Alter, Religion u. Ä. gefasst, wobei die Perspektive um vielfältige weitere individuelle Merkmale wie z. B. Wahrnehmung oder Belastbarkeit erweiterbar ist.
Diversität schlägt sich im Bereich der Unternehmensführung und auf Ebene von Institutionen als Diversity Management nieder – es stellt also vor allem ein Konzept der Organisations- und Personalentwicklung dar (vgl. Cordes 2010: 929; Charta der Vielfalt). Es wurde ursprünglich als US-amerikanisches Management-Konzept zur Bewältigung von Diskriminierungen entwickelt und kann weitestgehend als Folge einer Antidiskriminierungsbewegung verstanden werden (vgl. Bruchhagen/Koall 2010: 939). Diversity Management beschreibt die langfristige und auf eine ganzheitliche Perspektive abzielende Zielvorstellung, die Heterogenität bzw. Vielfalt der Mitarbeitenden wertzuschätzen und ihr Potenzial im Sinne des wirtschaftlichen Erfolgs eines Unternehmens zu nutzen. Dies hat Auswirkungen auf Personalprozesse und -politik und damit auf Unternehmensstrukturen und -kultur, die im Hinblick auf ihre Adäquatheit und Durchlässigkeit zu bewerten sind (vgl. Charta der Vielfalt). Zudem müssen optimale Bedingungen geschaffen werden, damit alle Beschäftigten Leistungspotenzial und -bereitschaft in vollem Umfang entwickeln können (vgl. Cordes 2010: 929). Übergeordnete Idee ist daher, dass die Vielfalt der Beschäftigten in allen Unternehmensbereichen ihren Ausdruck findet. Zur Umsetzung von Diversity Management verpflichten sich viele Unternehmen auf die wirtschaftspolitische Initiative Charta der Vielfalt, die von der Bundesregierung mitgetragen wird. Je nach Perspektive werden verschiedene Phasen unterschieden, in denen Diversity Management umgesetzt wird (vgl. etwa Charta der Vielfalt; Bruchhagen/Koall 2010: 940f.).
Diversity Management zielt zwar durchaus auf die 'Chancengleichheit der Geschlechter' und auf eine bessere Vereinbarkeit von Elternschaft und Beruf, so dass diese bei der Organisationsentwicklung bedacht werden muss, Diversity Management stellt aber keine speziell auf die Gleichstellung von Frauen ausgerichtete Maßnahme dar; vielmehr entfaltet sie im Idealfall positiven Nutzen für alle Beteiligten (vgl. bes. Cordes 2010: 929f.). Kritisiert wird am Diversity Management insbesondere der Fokus auf die Wirtschaftlichkeit. Die Diversität sei lediglich einem neoliberalen Denken untergeordnet und diene nicht dem Abbau von Ungleichheit, sondern dem Nutzen von Ressourcen. (vgl. dazu Hafen/Gretler Heusser 2008)
(Weiterführende) Literatur:
Bruchhagen, Verena/Koall, Iris (2010): Managing Diversity: Ein (kritisches) Konzept zur produktiven Nutzung sozialer Differenzen. In: Becker, Ruth/Kortendiek, Beate: Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie. 3. erweiterte und durchgesehene Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft, S. 939-946.
Charta der Vielfalt: Diversity-Management. Verfügbar unter: http://www.charta-der-vielfalt.de/diversity/diversity-management.html (letzter Zugriff: 17.04.2015).
Cordes, Mechthild (2010): Gleichstellungspolitiken: Von der Frauenförderung zum Gender Mainstreaming. In: Becker, Ruth/Kortendiek, Beate (Hrsg.) unter Mitarbeit von Budrich, Barbara/Lenz, Ilse/Metz-Göckel, Sigrid/Müller, Ursula/Schäfer, Sabine: Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie. 3. erweiterte und durchgesehene Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft, S. 924-932.
Frieß, Wiebke/Mucha, Anna/Rastetter, Daniela (2019): Diversity Management und seine Kontexte. Opladen: Budrich.
Hafen, Martin/Gretler Heusser, Simone (2008): Diversity Management – Mittel zur Anti-Diskriminierung, neoliberales Phänomen oder alter Wein in neuen Schläuchen? In: Gruppendynamik 39, 225–237.
‚Doing Gender‘ ist als Konzept aus der interaktionstheoretischen Soziologie hervorgegangen und wurde 1987 von Candace West und Don Zimmermann entwickelt. Die Herstellung von Geschlechtszugehörigkeit und -identität ist demnach ein alltäglicher wie unvermeidbarer Prozess; d. h., sie ist in Alltagssituationen eingebettet und strukturiert diese zugleich (vgl. Holzleithner 2002: 72; Gildemeister 2019: 410f). Dieser Vorgang der sozialen Konstruktion von Geschlecht ist jedoch in der Regel nicht sichtbar bzw. wird von den Beteiligten nicht wahrgenommen, da Geschlecht häufig in der Natur verortet, d. h. als biologisch gegeben und damit als selbstverständlich betrachtet wird.
West und Zimmermann unterscheiden zur Überwindung dieser biologistischen Sichtweise zwischen den Kategorien sex (bei Geburt vorgenommene Klassifikation des Körpergeschlechts aufgrund gesellschaftlich festgelegter biologischer Merkmale), sex category (soziale Zuschreibung des Geschlechts zu ‚männlich‘ und ‚weiblich‘ infolge der Applikation dieser Merkmale) und gender (Fähigkeit des Individuums, so zu agieren, dass das eigene Handeln/Auftreten mit der vorgenommenen sozialen Geschlechtszuschreibung übereinstimmt) (vgl. West/Zimmermann 1987: 131ff.; Faulstich-Wieland 2004: 177; Gildemeister 2019: 413;). Letztere beschreibt Gildemeister (2019: 413) daher auch als „intersubjektive Validierung in Interaktionsprozessen durch ein situationsadäquates Verhalten und Handeln“, welches wiederum der eingenommenen sex category entspricht. Hirschauer (1994: 672) hat daher drei „axiomatische Basisannahmen“ in Bezug auf Geschlecht identifiziert: (1) Die Annahme der Konstanz, d. h. einer lebenslänglichen Gültigkeit der Geschlechtszugehörigkeit einer Person, (2) die Annahme der Naturhaftigkeit sowie (3) der Dichotomizität, demnach ausschließlich von zwei polaren Geschlechtern, von männlich und weiblich ausgegangen wird (Hirschauer 1994; vgl. auch Faulstich-Wieland 2004: 179).
Entwickelt wurde das Konzept vor dem Hintergrund soziologischer Analysen zu Transsexualität, wofür Harold Garfinkels sogenannte „Agnes-Studie“ von 1967 grundlegend ist. Am Beispiel der Transsexuellen Agnes – Agnes entschied sich im Alter von 17 Jahrenzu einer Transition – konnte er veranschaulichen, was passiert, wenn die alltägliche zweigeschlechtliche Ordnung einer Gesellschaft ‚beschädigt‘ wird. Er zeigte, wie „voraussetzungsvoll“ die Anerkennung einer Person als männlich oder – wie im Fall von Agnes – weiblich ist (Garfinkel 1967). So gibt es gesellschaftliche Vorstellungen bzgl. ‚gelungener‘ Männlichkeit und Weiblichkeit (vgl. Holzleithner 2002: 72), die in Interaktionen durch geschlechtstypische Praktiken – etwa in Form von Mimik, Gestik, Körperhaltung, Sprache etc. – zu erfüllen sind. „Gender wird im Kontext einer routinisierten, permanent wiederholten Praxis erworben. Diese Praxis besteht aus Aktivitäten, die sich auf der Ebene der Darstellung sowie der Wahrnehmung als Manifestationen männlicher und weiblicher ‚Seinsweisen‘ zeigen.“ (Holzleithner 2002: 72) Gelingt diese Identifikation anderer Personen als männlich oder weiblich nicht und wird das Muster der Zweigeschlechtlichkeit durchbrochen, so ruft dies meist starke Irritationen und Verunsicherungen hervor. Garfinkel ging daher von einer Omnipräsenz bzw. -relevanz von Geschlecht aus (vgl. Garfinkel 1967: 118): Geschlechtszugehörigkeit und Zweigeschlechtlichkeit sind demnach Selbstverständlichkeiten des Alltagswissens unserer Gesellschaft, die nicht weiter hinterfragt werden (vgl. auch Wetterer 2010: 126). Dazu gehört auch die Annahme, dass dies immer so war und in allen Kulturen so ist (vgl. ebd.).
Bekannt ist in diesem Zusammenhang auch die Untersuchung von Suzanne J. Kessler und Wendy McKenna „Gender. An ethnomethodological Approach“ von 1978, in der sie bereits explizit von der sozialen Konstruiertheit von Geschlecht sprechen. Nicht nur untersuchen sie Praktiken der Geschlechtskonstruktion von Transsexuellen, darüber hinaus fragen sie erstmalig, auf welche Weise „Kinder sich die Regeln des kulturellen Systems der Zweigeschlechtlichkeit aneignen“ (Wetterer 2010: 128). Dies geschieht durch die Zuschreibung von Geschlechtszugehörigkeit zu einer Person: Wurde eine Person bereits als männlich oder weiblich identifiziert, so werden alle weiteren Handlungen im Lichte dieser vermeintlich ‚natürlichen‘ Geschlechtszugehörigkeit gesehen. Dies zeigt, wie wirkmächtig das kulturelle System der Zweigeschlechtlichkeit ist. West und Zimmermann gingen daher davon aus, dass es unvermeidbar ist, „gender“ nicht „zu tun“ (vgl. ausf. Gildemeister 2010: 143). Diese Sichtweise wird vor dem Hintergrund anderer wirkmächtiger gesellschaftlicher Zuschreibungen, die Wahrnehmung strukturierende Klassifikationsmerkmale wie race und class sowie im Rahmen des Ansatzes eines ‚undoing gender‘ (Hirschauer 1994) zum Teil infrage gestellt.
(Weiterführende) Literatur:
Faulstich-Wieland, Hannelore (2004): Doing Gender: Konstruktivistische Beiträge. In: Glaser, Edith/Klika, Dorle/Prengel, Annedore (Hrsg.): Handbuch Gender und Erziehungswissenschaft. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, S. 175-191.
Garfinkel, Harold (1967): Studies in Ethnomethodology. Cambridge: Polity Press.
Gildemeister, Regine (2019): Doing Gender: eine mikrotheoretische Annäherung an die Kategorie Geschlecht. In: Kortendieck, Beate; Riegraf, Birgit; Sabisch, Katja (Hrsg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung. Wiesbaden: Springer. S. 409-417.
Holzleithner, Elisabeth (2002): Doing Gender. In: Metzler Lexikon Gender Studies / Geschlechterforschung. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Hrsg. von Knoll, Renate. Stuttgart: J. B. Metzler, S. 72f.
Hirschauer, Stefan (1994): Die soziale Fortpflanzung der Zweigeschlechtlichkeit. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 46, S. 668-692.
Kessler, Suzanne J./Mckenna, Wendy (1978): Gender: An ethnomethodological approach. Chicago: University of Chicago Press.
Wetterer, Angelika (2010): Konstruktion von Geschlecht: Reproduktionsweisen der Zweigeschlechtlichkeit. In: Becker, Ruth/Kortendiek, Beate (Hrsg.) unter Mitarbeit von Budrich, Barbara/Lenz, Ilse/Metz-Göckel, Sigrid/Müller, Ursula/Schäfer, Sabine: Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie. 3. erweiterte und durchgesehene Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft, S. 126-136.
West, Candace/Zimmermann, Don H. (1987): Doing Gender. In: Gender & Society, Heft 2/1, S. 125-151.
Obwohl der Begriff Feminismus erst um 1880 durch die französische Frauenrechtlerin Hubertine Auclert geprägt wurde, hat es aus der Retrospektive betrachtet „seit jeher“ feministische Einsprüche gegen geschlechtsbezogene Unrechtserfahrungen und -strukturen gegeben. Anzuführen ist hier bspw. Christine de Pizan mit ihrem Werk Die Stadt der Frauen von 1404/05 (vgl. Gerhard 2018: 7f., 11). Als weitere Wegbereiterinnen des Feminismus – als eine Bewegung, die sich aus Erfahrungen der Unterdrückung und Ausbeutung speiste – sind beispielsweise und insbesondere die französische Frauenrechtlerin Olympe de Gouges mit ihrer Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin (1791) sowie die afroamerikanische Abolitionistin und Frauenrechtlerin Sojourner Truth mit ihrer Rede Ain’t I a woman? (1851) anzuführen; um nur einige frühe feministische Stimmen zu nennen. Doch erst Mitte des 19. Jahrhunderts schlossen sich im Rahmen der europäischen bürgerlichen Revolutionen und der Antisklavereibewegung in den USA Frauenvereinigungen zusammen, die sich weitestgehend geschlossen und systematisch der sogenannten ‚Frauenfrage‘ widmeten und den Zugang zu Politik, Bildung, Erwerbsleben und Selbstbestimmung forderten (vgl. u.a. Karl 2020; Karsch 2016; Thiessen 2010: 37). Ausgangspunkt von Feminismus stellt grundsätzlich die Kritik an der „Identifizierung“ (Thiessen 2010: 38) des weiblichen Subjekts als eine Gruppe dar, die den Männern nach- und damit untergeordnet ist. Das Anliegen von Feminismus ist es daher, die gesellschaftliche Position von Frauen und alle daraus resultierenden Benachteiligungen (vgl. zur „doppelten Vergesellschaftung von Frauen“ ausführlicher Becker–Schmidt 2010: 65) besonders im Hinblick auf stark geschlechtlich strukturierte Bereiche wie Produktion, Reproduktion und Regeneration zu verändern. Dies schließt auch die Analyse derjenigen politischen, ökonomischen und sozialen Prozesse ein, die die Unterdrückung resp. Benachteiligung von Frauen hervorgebracht haben bzw. hervorbringen. Regina Becker-Schmidt (2010) beschreibt daher das Geschlechterverhältnis als ein „Ensemble von Arrangements […], in denen Frauen und Männer durch Formen der Arbeitsteilung, soziale Abhängigkeitsverhältnisse und Austauschprozesse aufeinander bezogen sind.“ (ebd.: 69)
Im Zeitverlauf hat es Veränderungen, unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und Zielgruppen innerhalb des Feminismus gegeben: Während in den 1980er Jahren bspw. vor allem ökofeministische Positionen vertreten wurden, die Kategorien wie ,Natur‘ und ,Frau‘ auf ihre strukturellen Zusammenhänge hin untersuchten und damit einhergehende Ausbeutungsverhältnisse aufzeigten, wurden diese als essentialistisch und naturalisierend zu bewertenden Weiblichkeitsbilder innerhalb der feministischen Naturwissenschaftskritik und durch das zunehmende Einwirken poststrukturalistischer Konzepte ab Mitte der 1980er Jahre kritisiert (vgl. Thiessen 2010: 39f.). Dabei hat der Feminismus durchaus neue Ausschlüsse und „Hegemonien“ (ebd.: 40) mit sich gebracht, die u. a. von Judith Butler (1990) kritisiert wurden: Nicht nur wurde angemerkt, dass die Kategorie ‚Frau‘ als grundlegend vorausgesetzt und Differenzen zwischen Frauen oder andere Marginalisierungen nicht thematisiert wurden, zugleich werden andere, teils mit Geschlecht interagierende Merkmale wie race, class oder ethnicity nicht berücksichtigt (vgl. ausführlicher Thiessen 2010: 40f.). Gegenwärtige feministische Ansätze stehen somit insbesondere vor der Herausforderung, zunehmend intersektionale Perspektiven in den Blick zu nehmen.
Da es nicht die eine feministische Theorie gibt, sondern unterschiedliche Positionen und Theorierichtungen innerhalb des Feminismus, ist es treffender von Feminismen als von Feminismus zu sprechen. Je nach Schwerpunktsetzung bei der Betrachtung feministischer Strömungen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und Versuche, Feminismen mit ihren Anliegen und Forderungen zu systematisieren. Eine gängige Systematisierungsweise ist hierbei die Einteilung in sog. Wellen. Auf globaler Ebene betrachtet wird die sog. erste Welle des Feminismus ab 1840 angesetzt, die zweite Welle folgte ab 1960 und die dritte Welle setzte ab 1990 ein. Neben der Einteilung der feministischen Bewegungen in Wellen, stellt die Einteilung in Differenz- oder Gleichheitsfeminismus eine weitere gängige Möglichkeit der Sortierung dar (vgl. hierzu insb. Holland-Cunz 2018, Lenz 2018). Zudem ist generell „zwischen Feminismus als einer kritischen Gesellschaftstheorie und Feminismus als sozialer Bewegung von Frauen [und emanzipativen Männern]“ (Gerhard/Pommerenke/Wischermann 2008: 9) zu unterscheiden.
Ziel der Etablierung von Frauen- und Geschlechterforschung an Hochschulen sowie anderen Weiterbildungseinrichtungen ist daher die Förderung des Transfers von Theorie und Praxis sowie eine Verbreitung, Ausweitung sowie Systematisierung der feministischen Theoriebildung (vgl. Thiessen 2010: 38). Sigrid Metz-Göckel (2003) bezeichnet den Feminismus daher auch als „Theorie“, die Frauenbewegung hingegen als „Praxis“ (vgl. ebd: 170ff.; zit. nach Thiessen 2010: 38).
Auch wenn aus Sicht des Feminismus durchaus Gewinne auf der Ebene von Bildung, Gleichstellung, Menschenrechten und sexueller Selbstbestimmung zu verzeichnen sind, bestehen durchaus Ungleichheiten, Ausschlüsse und Diskriminierungen auf struktureller wie institutioneller Ebene weiter fort, die es zu bearbeiten gilt.
(Weiterführende) Literatur:
Becker-Schmidt, Regina (2010): Doppelte Vergesellschaftung von Frauen: Divergenzen und Brückenschläge zwischen Privat- und Erwerbsleben. In: Becker, Ruth/Kortendiek, Beate (Hrsg.) unter Mitarbeit von Budrich, Barbara/Lenz, Ilse/Metz-Göckel, Sigrid/Müller, Ursula/Schäfer, Sabine: Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie. 3. Erweiterte und durchgesehene Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft, S. 65-74.
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) (2019): We are Feminists! Eine kurze Geschichte der Frauenrechte. Mit einem Vorwort von Margarete Stokowski. Bonn.
Butler, Judith (1990): Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. New York u. a.: Routledge.
Böll. Thema 2/2018: Demokratie braucht Feminismus. Online verfügbar unter: https://www.boell.de/de/2018/07/02/boellthema-22018-demokratie-braucht-feminismus. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Gerhard, Ute (2018): Frauenbewegung und Feminismus. Eine Geschichte seit 1789. 3., aktualisierte Aufl. München: C.H. Beck.
Gerhard, Ute/ Pommerenke, Petra/ Wischermann, Ulla (2008): Einleitung. In: dies. (Hrsg.): Klassikerinnen feministischer Theorie. Grundlagentexte Band I (1789-1919). Königstein/Taunus: Ulrike Helmer, S. 9-13.
Holland-Cunz, Barbara (2018): Was ihr zusteht. Kurze Geschichte des Feminismus. In: APuZ 17/2018 [(Anti-)Feminismus], S. 4-11. Online verfügbar unter: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/267949/anti-feminismus/. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Karl, Michaela (2020): Die Geschichte der Frauenbewegung. 6., aktual. u. erw. Auflage. Ditzingen: Reclam.
Karsch, Margret (2016): Feminismus. Geschichte – Positionen. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung (bpb).
Lenz, Ilse (2019): Feminismus: Denkweisen, Differenzen, Debatten. In: Kortendiek, Beate/Riegraf, Birgit/Sabisch, Katja (Hrsg.): Handbuch interdisziplinäre Geschlechterforschung, Bd. 1. Wiesbaden: Springer VS, S. 231-241.
Lenz, Ilse (2019): Internationale und transnationale Frauenbewegungen: Differenzen, Vernetzungen, Veränderungen. In: Kortendiek, Beate/Riegraf, Birgit/Sabisch, Katja (Hrsg.): Handbuch interdisziplinäre Geschlechterforschung, Bd. 2. Wiesbaden: Springer VS, S. 901-910.
Lenz, Ilse (2018): Von der Sorgearbeit bis #metoo: Aktuelle feministische Themen und Debatten in Deutschland. In: APuZ 17/2018 [(Anti-)Feminismus], S. 20-27. Online verfügbar unter: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/267949/anti-feminismus/. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Thiessen, Barbara (2010): Feminismus: Differenzen und Kontroversen. In: Becker, Ruth/Kortendiek, Beate (Hrsg.) unter Mitarbeit von Budrich, Barbara/Lenz, Ilse/Metz-Göckel, Sigrid/Müller, Ursula/Schäfer, Sabine: Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie. 3. erweiterte und durchgesehene Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft, S. 37-44.Schulz, Kristina (2019): Frauenbewegungen im deutschsprachigen Raum: Geschlecht und soziale Bewegung. In: Kortendiek, Beate/Riegraf, Birgit/Sabisch, Katja (Hrsg.): Handbuch interdisziplinäre Geschlechterforschung, Bd. 2. Wiesbaden: Springer VS, S. 911-920.
Entstanden aus der Neuen Frauenbewegung in den 1970er Jahren verstand sich die Frauenforschung zunächst als parteiische Forschung von Frauen über Frauen und als Wissenschaftskritik im Sinne des Ausschlusses von Frauen als Forschungsobjekt wie auch als Wissenschaftlerinnen (vgl. Brüns 2002: 120). Ziele waren (1) die Unterminierung der androzentrischen Strukturen im Hochschulbereich, (2) die Rekonstruktion weiblicher Traditionen in den Fachwissenschaften und (3) die Frage nach der Asymmetrie sozialer Geschlechterverhältnisse sowie nach „symbolischen Konstruktionen von Weiblichkeit und Geschlecht.“ (ebd.: 121).
Ab den 1980ern nahm jedoch das Bewusstsein dafür zu, dass es ‚die‘ Frauen als in sich geschlossene Gruppe nicht gibt. So bestehen etwa Unterschiede auf Ebenen von race und class, die erhebliche soziale Ungleichheiten nach sich ziehen. Der Fokus der Frauenforschung liegt daher heute allgemeiner auf der empirischen, theoretischen sowie ideologiekritischen Analyse derjenigen Verhältnisse, die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern bedingen (vgl. ebd.: 119f.). Da ähnlich wie bei den Gender Studies bzw. der Geschlechterforschung Geschlechterrelationen betrachtet werden, gibt es zwar durchaus Überschneidungen bzw. Gemeinsamkeiten bezüglich des Forschungsgegenstandes; so ist auch hier das doing gender Gegenstand kritischer Auseinandersetzungen (vgl. ebd.: 120). Dennoch wird sex innerhalb der Frauenforschung weniger als „Naturalisierungseffekt des sozialen Geschlechts“, sondern primär als „Grundlagenkategorie“ (ebd.) gedacht. Aus diesem Grunde wird der Frauenforschung oftmals der Vorwurf gemacht, Geschlechterunterschiede zu essentialisieren.
(Weiterführende) Literatur:
Brüns, Elke (2002): Frauenforschung. In: Metzler Lexikon Gender Studies / Geschlechterforschung. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Hrsg. von Knoll, Renate. Stuttgart: J. B. Metzler 2002, S. 119-121.
Frey Steffen, Therese (2017): Gender. Ditzingen: Reclam, daraus insb. S. 31ff.
Karsch, Margret (2016): Feminismus. Geschichte – Positionen. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, daraus S. 150ff.
Metz-Göckel, Sigrid (2019): Frauenhochschulbewegung: Selbstermächtigung und Wissenschaftskritik. In: Kortendiek, Beate/Riegraf, Birgit/Sabisch, Katja (Hrsg.): Handbuch interdisziplinäre Geschlechterforschung, Bd. 2. Wiesbaden: Springer VS, S. 1033-1042.
Die Einführung und Anwendung von sog. Frauenquoten in Bereichen des öffentlichen Dienstes, der Wissenschaft, Privatwirtschaft und Politik hat zum Ziel, „Frauen den gleichen Zugang zu Schlüsselpositionen zu ermöglichen wie Männern“ (Hendrix 2019: 94). Auf Vorschlag des Bundesministers der Justiz und für Verbraucherschutz, Heiko Maas (SPD), und der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Manuela Schwesig (SPD), stimmte der Bundestag am 6. März 2015 mit großer Mehrheit für den Gesetzentwurf zur Frauen- bzw. Geschlechterquote für die Privatwirtschaft und den öffentlichen Dienst.
Die Frauenquote stellt eine Antwort der Politik auf die nach wie vor bestehende Diskriminierung von Frauen beim Aufstieg in Führungspositionen von Unternehmen dar; so verbleiben diese trotz gleicher Qualifikationen im Vergleich zu Männern auf Ebenen des mittleren Managements und werden aus verschiedenen Gründen am Aufstieg gehindert (siehe zu den Ursachen auch den Eintrag zur Gläsernen Decke). Seit der Einführung des ersten Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen (FüPoG 2015) lässt sich ein Anstieg des Frauenanteils in den Führungsetagen deutscher Unternehmen verzeichnen: Wohingegen der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der 200 größten Unternehmen in Deutschland 2014 nur 18,4 Prozent betrug, so lag dieser im Jahr 2021 bei 30.4 Prozent. Und wohingegen der Frauenanteil in den Vorständen dieser Unternehmen 2014 bloß 5,4 Prozent betrug, so lag dieser 2021 bei 14.7 Prozent (vgl. Kirsch/Sondergeld/Wrohlich 2022; Statista 2021: 4f.). Darüber hinaus ist auch ein Anstieg des Frauenanteils in den Aufsichtsräten (34,7 Prozent im Jahr 2021) und in den Vorständen (17,5 Prozent im Jahr 2021) der DAX-Unternehmen in Deutschland zu verzeichnen (vgl. Statista 2021: 11f.).
Die Frauenquote ist bei der Neubesetzung von Aufsichtsratposten und auf den oberen Führungsebenen von börsennotierten und voll mitbestimmungspflichtigen Unternehmen in der Privatwirtschaft verbindlich. Seit dem 01. Januar 2016 ist eine sog. fixe Quote von 30 Prozent bei der Besetzung von Aufsichtsräten bindend. Unternehmen, die entweder mitbestimmungspflichtig oder börsenorientiert sind, müssen seit Einführung von FüPoG Zielgrößen für Vorstand, Aufsichtsrat und Posten des mittleren und oberen Managements festlegen. Diese müssen von den Unternehmen basierend auf dem Status Quo selbst festgesetzt werden, wobei erstere verpflichtet sind, zusammen mit der Umsetzung öffentlich darüber zu berichten (vgl. Die Bundesregierung 2015). Im öffentlichen Dienst gilt seit 2016 eine entsprechende Quote von 30 Prozent, bis 2025 sollen die Führungspositionen paritätisch besetzt sein (vgl. BMFSFJ 2022).
Mit dem Zweiten Führungspositionen-Gesetz (FüPoG II) gelten seit August 2021 weitere verbindliche Vorgaben für die Vorstands- und Aufsichtsgremien deutscher Unternehmen:
- Mindestbeteiligung
„Die bewährte fixe Quote für Aufsichtsräte aus dem FüPoG wird mit dem FüPoG II durch ein Mindestbeteiligungsgebot für Vorstände ergänzt. Börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen müssen künftig mindestens eine Frau in den Vorstand berufen, wenn ihr Vorstand aus mehr als drei Personen besteht.“ (BMFSFJ 2021a)
- Verpflichtende Regelungen zu Zielgrößen und Berichtspflichten
„Unternehmen müssen sich seit Inkrafttreten des FüPoG 2015 Zielgrößen für die zukünftige Beteiligung von Frauen für die obersten Führungsebenen setzen, also für Aufsichtsrat, Vorstand sowie die erste und zweite Managementebene. Oft lautete die Zielgröße Null. Das ist mit Inkrafttreten des FüPoG II nicht länger akzeptabel. Unternehmen werden künftig begründen müssen, wenn sie sich für den Vorstand null Frauen als Ziel setzen. Im Handelsbilanzrecht wurde eine entsprechende Berichtspflicht eingeführt.“ (BMFSFJ 2021a)
Unternehmen, die keine Zielgröße melden oder keine Begründung für die Zielgröße Null angeben, droht ein erhebliches Bußgeld (vgl. BMFSFJ 2021a). Mit der Einführung des FüPoG II ist die gesetzliche Quotenregelung schließlich auch auf die Besetzung der Vorstände in DAX-Unternehmen erweitert worden.
Neben den Hauptanwendungsfeldern von Quotenreglungen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst werden „Frauenquoten [auch] in der Politik […] als Mittel gegen die Unterrepräsentanz von Frauen in Parlamenten diskutiert. Als Hauptproblem gilt die KandidatInnenaufstellung in Parteien“ (Hendrix 2019: 998). Aktuell wird die schrittweise Einführung einer Frauenquote innerhalb der CDU diskutiert.
Um mehr über eine entsprechende Quotierung in der Wissenschaft zu erfahren, siehe Eintrag zu Kaskadenmodell.
(Weiterführende) Literatur:
Bundesministerium der Justiz (BMJ) (2021): Frauen in Führungspositionen: Die Quote wirkt. Pressemitteilung vom 20. Oktober 2021. Verfügbar unter: https://www.bmj.de/SharedDocs/Archiv/DE/Pressemitteilungen/2021/1020_Fuepog.html?nn=17107052. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2022): Mehr Frauen in Führungspositionen im öffentlichen Dienst. 10.02.2022. Verfügbar unter: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-und-arbeitswelt/quote-oeffentlicher-dienst. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2021a): Mehr Frauen in Führungspositionen in der Privatwirtschaft (Zweites Führungspositionen-Gesetz FüPoG II). 02.11.2021. Verfügbar unter: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-und-arbeitswelt/quote-privatwitschaft/mehr-frauen-in-fuehrungspositionen-in-der-privatwirtschaft-78562. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2021b): Umsetzungsstand der Maßnahmen der Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung nach Zielen. 24.09.2021. Verfügbar unter: https://www.bmfsfj.de/resource/blob/186044/e73f3b976eb878159250fa2471bd5436/umsetzungsstand-der-massnahmen-der-gleichstellungsstrategie-der-bundesregierung-nach-zielen-data.pdf. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2020): Gleichstellung und Teilhabe. Frauen und Politik. 31.03.2020. Verfügbar unter: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/gleichstellung-und-teilhabe/frauen-und-politik/frauen-und-politik-80454. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Die Bundesregierung: Gleichstellung. Die Frauenquote kommt. Stand: 27.03.2015. Verfügbar unter: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/die-frauenquote-kommt-321070. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Hendrix, Ulla (2019): Frauenquote: zwischen Legitimität, Effizienz und Macht. In: Kortendiek, Beate/Riegraf, Birgit/Sabisch, Katja (Hrsg.): Handbuch interdisziplinäre Geschlechterforschung, Bd. 2. Wiesbaden: Springer VS, S. 993-1002.
Kirsch, Anja/ Sondergeld, Virginia/ Wrohlich, Katharina (2022): Deutlich mehr Vorständinnen in großen Unternehmen – Beteiligungsgebot scheint bereits zu wirken. DIW Wochenbericht 3/ 2022, S. 22-33. Verfügbar unter: https://www.diw.de/de/diw_01.c.833645.de/publikationen/wochenberichte/2022_03_2/deutlich_mehr_vorstaendinnen_in_grossen_unternehmen_-_beteiligungsgebot_scheint_bereits_zu_wirken.html. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Klammer, Ute/Menke, Katrin (2020): Gender-Datenreport. Informationen zur politischen Bildung/izp 1/2020 [Geschlechterdemokratie], S. 20-33. Verfügbar unter: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/307470/geschlechterdemokratie/. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Statista (2021): Frauenquote. Dossier. Verfügbar unter: https://de.statista.com/statistik/studie/id/9993/dokument/frauenquote-statista-dossier/. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Im Deutschen gibt es kein Pendant für den - zunächst ausschließlich auf das grammatische Geschlecht bezogenen - englischen Begriff, der als ‚soziales Geschlecht‘ übersetzt wird (vgl. Wende 2002:141). Der Terminus ‚Gender‘ macht deutlich, dass die geschlechtliche Identität eines Menschen nicht angeboren, d. h. biologisch bedingt ist, sondern vielmehr einen durch Zuschreibungen geprägten wechselseitigen Aneignungsprozess darstellt (vgl. ebd.; siehe auch das Konzept doing gender). Demnach liegen Männlichkeit und Weiblichkeit nicht in der Natur begründet, sondern sind historisch-zeitgebunden konstruiert (vgl. ebd.), d. h. als ein Ergebnis historischer Entwicklungsprozesse sowie von sozialer Praxis zu betrachten. Im historischen oder räumlichen Vergleich wird dies etwa deutlich. So kennen nicht alle Gesellschaften nur zwei Geschlechter, schreiben Geschlechtszugehörigkeit als lebenslang vor und weisen letztere auf Basis der Geschlechtsmerkmale zu (vgl. Wetterer 2010: 127). Dementsprechend besagt auch die „Null-Hypothese“ von Carol Hagemann-White (2001), dass keine durch die Natur vorgeschriebene Zweigeschlechtlichkeit existiert, sondern vielmehr unterschiedliche Geschlechtskonstruktionen, die je nach Kultur divergieren (vgl. ebd.: 30). Während lange Zeit zwischen sex als vermeintlich biologischem und gender als sozialem Geschlecht unterschieden wurde, wird diese Trennung spätestens im Anschluss an Joan W. Scott (1988) und Judith Butler (1990) infrage gestellt: So gehe es immer, d. h. auch bei sex, um soziokulturelle Zuschreibungen, so dass das ‚biologische‘ Geschlecht nicht Basis oder dieser vorgängig ist, sondern gleichermaßen wie gender eine Folge von sozialer Praxis darstellt und demnach kulturellen Änderungen ausgesetzt ist.
(Weiterführende) Literatur:
Butler, Judith (1990): Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. New York u.a.: Routledge.
Hagemann-White, Carol (2001): Wir werden nicht zweigeschlechtlich geboren ... In: Hark, Sabine (Hg.): Dis/Kontinuitäten: Femnistische Theorie.Opladen: Leske + Budrich. S. 24-34.
Scott, Joan W. (1988): Gender and the Politics of History. New York: Columbia University Press.
Villa, Paula-Irene (2019): Sex – Gender: Ko-Konstitution statt Entgegensetzung: In: Kortendieck, Beate; Riegraf, Birgit; Sabisch, Katja (Hrsg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung. Wiesbaden: Springer. S. 23-33.
Wende, Waltraud (2002): Gender/Geschlecht. In: Metzler Lexikon Gender Studies / Geschlechterforschung. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Hrsg. von Knoll, Renate. Stuttgart: J. B. Metzler, S. 141-142.
Wetterer, Angelika (2010): Konstruktion von Geschlecht. Reproduktionsweisen der Zweigeschlechtlichkeit. In: Becker, Ruth/Kortendiek, Beate (Hg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie. 3. erweiterte und durchgesehene Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 126-136.
Der Begriff Genderkompetenz ist an sich nicht unproblematisch, da dieser suggeriert, dass es sich hierbei im Sinne von Anwendungsbeispielen um eine erlernbare Technik „zum ‚richtigen Umgang mit Gender‘“ (Rendtorff 2011: 223) handelt. Barbara Rendtorff (2011: 223) merkt daher auch an, „dass der Umgang mit Effekten aus dem Geschlechterverhältnis nicht eine Frage der Verhaltensstrategie [ist], sondern zuallererst eine Sache des Bewusstseins, der (Selbst-)Aufmerksamkeit, der Reflexion und nicht zuletzt der Kenntnis gesellschaftlicher Zusammenhänge und stereotypen Zuschreibungen[...]“ (ebd.). Eher eignet sich daher der Begriff der Geschlechtersensibilität oder – in Bezug auf pädagogische Kontexte – der geschlechtersensiblen oder auch -reflektierten Pädagogik, der vor allem auf eine Reflexionskompetenz der Beteiligten zielt: Neben einer entsprechenden Haltung, mit der anderen Menschen in pädagogischen Kontexten begegnet wird – diese schließt insbesondere die Anerkennung der Vielfalt geschlechtlicher Existenzweisen sowie von Benachteiligungen und Machtverhältnissen zwischen Frauen und Männern mit ein –, erfordert eine solche Pädagogik Wissen und methodisch-didaktische Überlegungen (vgl. dazu ausf. Debus et al. 2012: 10ff.). Budde und Venth (2010: 23f.) verwenden in Anlehnung an Kunert-Zier (2005) daher auch die Begriffe „Können“, „(Gender)Wissen“ und „Wollen“. Eine entsprechende Pädagogik basiert dementsprechend vor allem auch auf einer Geschlechtertheorie: So sind Kenntnisse über gesellschaftliche Geschlechterverhältnisse und -stereotype, über ihr (historisches) Gewordensein, daraus resultierende Ungleichheiten sowie über den Konstruktionscharakter von Weiblichkeit(en) und Männlichkeit(en) für eine entsprechende Reflexionskompetenz grundlegend. Obwohl es kein ‚festes Repertoire‘ an Verhaltensvorschriften und -strategien für gendersensibles/-bewusstes/-reflektiertes Handeln bspw. für den Bereich der Schule gibt, so kann doch auf Anlaufstellen verwiesen werden, die im Sinne einer Genderkompetenz in pädagogischen Settings aufklären und Ansatzmöglichkeiten für ein solches Handeln anbieten:
- QUA-LIS NRW (Landesinstitut für Schule). Zu den Aufgabenschwerpunkten der QUA-LIS gehört u.a. die Förderung und Umsetzung von Gendersensibler Bildung, zu deren Zielen z.B. die Vermeidung von benachteiligenden Geschlechterstereotypen in der Schule und die Berücksichtigung geschlechtlicher Vielfalt gehören. Die QUA-LIS orientiert sich hierbei v.a. an den „Leitlinien zur Sicherung der Chancengleichheit durch geschlechtersensible Bildung und Erziehung“ der Kultusministerkonferenz (KMK) (2016).
- Klischeefrei. Initiative zur Berufs- und Studienwahl (gefördert von: BMBF und BMFSFJ)
- Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V. (anerkannter Träger: bpb)
- QUEER FORMAT. Fachstelle Queere Bildung
(Weiterführende) Literatur:
Budde, Jürgen/Venth, Angela (2010): Genderkompetenz für lebenslanges Lernen. Bildungsprozesse geschlechterorientiert gestalten. Bielefeld: Bertelsmann.
Debus, Katharina/Könnecke, Bernard/Schwerma, Klaus/Stuve, Olav (2012): Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen an der Schule. Konzeptionelle Grundlagen und Schlussfolgerungen aus einer Fortbildungsreihe. In: Dissens e.V. & Dies. (Hrsg.): Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen an der Schule. Texte zu Pädagogik und Fortbildung rund um Jungenarbeit, Geschlecht und Bildung. Berlin: Dissens e.V., S. 10-16. Verfügbar unter: https://www.dissens.de/geschlechterverhaeltnisse. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Kunert-Zier, Margitta (2005): Erziehung der Geschlechter. Entwicklungen, Konzepte und Genderkompetenz in sozialpädagogischen Feldern. Wiesbaden: Springer VS.
Rendtorff, Barbara (2011): Genderkompetenz [Stichworte und Begriffe aus der Geschlechterforschung]. In: Rendtorff, Barbara/Mahs, Claudia/Wecker, Verena (Hrsg.): Geschlechterforschung. Theorien, Thesen, Themen zur Einführung. Stuttgart: Kohlhammer, S. 223.
Im Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung (2017) wird der Gender Pay Gap (geschlechtsspezifische Lohnlücke) neben dem Gender Lifetime Earnings Gap, Gender Pension Gap, Gender Time Gap und Gender Care Gap (auch: Gender Unpaid Gap) als ein relevanter Indikator für geschlechterbezogene Ungleichheiten in der Erwerbs- und Sorgearbeit genannt (vgl. BMFSFJ 2017: 93ff.). Als Gender Pay Gap (GPG) wird der trotz Frauenförderung, Gleichstellung und Gender Mainstreaming weiter fortbestehende prozentuale Gehaltsunterschied in Bezug auf den durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von Frauen und Männern bezeichnet. Seit dem Jahr 2006 stellt EU-einheitlich die vierjährliche Verdienststrukturerhebung die Datengrundlage dar, welche vom Statistischen Bundesamt ausgewertet wird.
So lag der durchschnittliche Bruttostundenlohn von Frauen in Deutschland –für die alten und die neueren Bundesländer gibt es erhebliche Unterschiede – laut Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2006 bei 23 Prozent und im Jahr 2018 bei 20 Prozent („unbereinigter“ Gender Pay Gap) unter demjenigen der Männer, womit sich Deutschland im EU-Vergleich auf einem der letzten Plätze befindet (vgl. Klammer&Menke 2020: 29; Statistisches Bundesamt 2022). Diese Gehaltsdifferenz kann auf Basis von verschiedenen Faktoren betrachtet werden, welche je nach Situation in unterschiedlichem Maße wirksam werden und dabei interagieren (vgl. u. a. BMFSJ: 4, 35f.):
- Frauen sind häufiger in niedrig bezahlten Berufen, vor allem im Dienstleistungssektor, beschäftigt, arbeiten öfters in Teilzeit und sind kaum in Führungspositionen zu finden – dies zum einen aufgrund der Art der von ihnen verrichteten Tätigkeiten, zum anderen aus strukturellen Gründen, die sich mit Begriffen wie ‚Gläserne Decke‘ oder ‚Leaky-Pipeline‘ umschreiben lassen. So sind Anforderungen des Arbeitsplatzes hinsichtlich Qualifikation und Führungskompetenz immer noch stark geschlechtstypisch segregiert.
- Aber auch bei vergleichbarer Tätigkeit und äquivalenter Qualifikation verdienen Frauen durchschnittlich 6 Prozent („bereinigter“ Gender Pay Gap, Daten von 2018) weniger als Männer, was häufig mit weiteren lohnrelevanten Aspekten – wie z. B. häufigere und längere Erwerbsunterbrechungen durch Familienzeiten – erklärt wird (vgl. Statistisches Bundesamt 2022; Klammer&Menke 2020: 29).
- Zugleich spielt die niedrigere Bewertung von vornehmlich von Frauen gewählten Berufen – etwa im Erziehungs- und Pflegebereich – eine Rolle. Diese ist als ein Produkt der Trennung von öffentlichem und privatem Bereich im Zuge der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert und damit der geringeren Wertschätzung aller Arbeiten, die der Reproduktion und Regeneration der Gesellschaftsmitglieder dienen, zu bewerten.
(Weiterführende) Literatur:
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2017): Zweiter Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. Verfügbar unter: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/zweiter-gleichstellungsbericht-119796. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Bundesministerium für Familie, Senioren Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2009): Entgeldungleichheit zwischen Frauen und Männern in Deutschland. Dossier. Berlin 2009. Verfügbar unter: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/entgeltungleichheit-zwischen-frauen-und-maennern-in-deutschland-80408. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Klammer, Ute/Menke, Katrin (2020): Gender-Datenreport. Informationen zur politischen Bildung/izp 1/2020 [Geschlechterdemokratie], S. 20-33. Verfügbar unter: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/307470/geschlechterdemokratie/. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Lillemeier, Sarah (2019): Gender Pay Gap: von der gesellschaftlichen und finanziellen Abwertung von „Frauenberufen“. In: Kortendiek, Beate/Riegraf, Birgit/Sabisch, Katja (Hrsg.): Handbuch interdisziplinäre Geschlechterforschung, Bd. 2. Wiesbaden: Springer VS, S. 1013-1021.
Statistisches Bundesamt (2022): Pressemitteilung Nr. 088 vom 07.März 2022. Verfügbar unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/03/PD22_088_621.html. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Statistisches Bundesamt: Gender Pay Gap 2020: Deutschland bleibt eines der EU-Schlusslichter. Verfügbar unter: https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Bevoelkerung-Arbeit-Soziales/Arbeitsmarkt/GenderPayGap.html. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Zinke, Guido (2020): Geschlechterungleichheiten: Gender Pay Gap. Bundeszentrale für politische Bildung. Verfügbar unter: https://www.bpb.de/themen/arbeit/arbeitsmarktpolitik/318555/geschlechterungleichheiten-gender-pay-gap/. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
„Die Institutionalisierung der deutschsprachigen Gender Studies ist eng mit der Geschichte der Frauen- und Geschlechterforschung verbunden. Das Studienfach Gender Studies zeichnet sich dabei durch eine interdisziplinäre Forschungsperspektive aus, welche die Kategorie Geschlecht in den Mittelpunkt wissenschaftlicher Analysen setzt“ (Brand&Sabisch 2019: 1044). Ab den 1990er Jahren hat zunehmend eine Umbenennung der ehemals als „Frauenforschung“ oder „Frauenstudien“ bezeichneten Studienfächer in „Geschlechterforschung“ bzw. „Gender Studies“ stattgefunden (vgl. ebd.). Da die Gender Studies auf einem relationalen Verständnis der Kategorie Geschlecht basieren, liegt ihr Fokus auf der Entstehung und Entwicklung von Geschlechterverhältnissen und -ordnungen in Bereichen von Gesellschaft, Kultur und Wissen(schaft) (vgl. u.a. Hark 1998).
Die Kategorie Geschlecht wird unter Berücksichtigung der gleichermaßen Frauen* wie Männern* zugeschriebenen Rollen, Funktionen und Attribute als ein soziales Konstrukt verstanden, das historisch-kulturellen Wandlungen unterliegt. Der Ausdruck Geschlecht oder Gender wird demnach „nicht (nur) als individuelle Eigenschaft oder Kennzeichnung einer Person aufgefasst, sondern als soziales Verhältnis innerhalb politisch und historisch gewachsener und veränderlicher Gesellschaftsstrukturen” (Rendtorff 2011: 224). Dementsprechend stellte das von der Anthropologin Gayle Rubin entwickelte sex/gender-System über lange Zeit ein grundlegendes Modell der Gender Studies dar (vgl. Feldmann/Schülting 2002: 144) – Judith Butlers (1990) These, dass auch sex diskursiv konstruiert sei, wurde hingegen erst später in die eigenen Arbeiten aufgenommen (vgl. Funk 2002: 156).
Zentraler Forschungsgegenstand der Gender Studies besteht entsprechend in der Analyse des hierarchischen Geschlechterverhältnisses – etwa in Bezug auf die Geschlechterdifferenz, die Geschlechtsrolle und Geschlechtsidentität – sowie dessen Manifestation in verschiedenen Gesellschaftsbereichen bzw. -feldern. Dabei werden durchaus auch Asymmetrien im Geschlechterverhältnis in verschiedenen Gesellschaftsbereichen in den Blick genommen, vorrangiges Interesse gilt aber vor allem der Frage nach der „Funktion”, „Konstitution” wie „Ausformung” von Geschlechterdifferenz (vgl. Feldmann/Schülting 2002: 143). Trotz einer gemeinsamen theoretischen Grundlage und vielfältiger Überschneidungen können die Zugänge in den Geschlechterstudien jedoch je nach fachdisziplinärer Schwerpunktsetzung divergieren.
Je nach Perspektive werden Gender Studies und Geschlechterforschung entweder synonym gesetzt, oder letztere wird als eine für den deutschen Raum spezifische Ausrichtung verstanden (vgl. Funk 2002: 154f.), die jedoch andere Forschungsgegenstände hat und sich hinsichtlich des institutionellen Kontextes unterscheidet (zur Unterscheidung zwischen Geschlechterforschung und Gender Studies siehe Hahn 2002: 156f.). Der Terminus gender wird dabei oftmals aufgrund der Eigenständigkeit als beweglicher wahrgenommen als die deutsche Bezeichnung ,Geschlecht‘, die sowohl sex – sprich das ‚biologische‘ Geschlecht – als auch gender umfasst (vgl. ebd.: 157). Die Gender Studies werden zwar zunehmend als eigenständige Disziplin wahrgenommen, doch es bleibt weiterhin schwierig von „den“ Gender Studies zu sprechen, da es sich um ein Studienfach handelt, dessen „Theorieentwicklung noch sehr in Bewegung und [dessen] Wissensfundament […] nicht kanonisiert“ (Rendtorff/Mahs/Wecker 2011: 8) ist.
(Weiterführende) Literatur:
Brand, Maximiliane/Sabisch, Katja (2019): Gender Studies: Geschichte, Etablierung und Praxisperspektiven des Studienfachs. In: Kortendiek, Beate/Riegraf, Birgit/Sabisch, Katja (Hrsg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung. Wiesbaden: Springer, S. 1043-1051.
Feldmann, Doris/Schülting, Sabine (2002): Gender Studies/Gender-Forschung. In: Metzler Lexikon Gender Studies / Geschlechterforschung. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Hrsg. von Knoll, Renate. Stuttgart: J. B. Metzler, S. 143-145.
Funk, Julika (2002): Geschlechterforschung. In: Metzler Lexikon Gender Studies / Geschlechterforschung. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Hrsg. von Knoll, Renate. Stuttgart: J. B. Metzler, S. 155-156.
Frey Steffen, Therese (2017): Gender. Ditzingen: Reclam, daraus insb. S. 31ff.
Hahn, Barbara (2002): Geschlechterforschung und Gender Studies. In: Metzler Lexikon Gender Studies / Geschlechterforschung. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Hrsg. von Knoll, Renate. Stuttgart: J. B. Metzler, S. 156f.
Hark, Sabine (1998): Disziplinäre Quergänge. (Un)Möglichkeiten transdiziplinärer Frauen- und Geschlechterforschung. In: Potsdamer Studien zur Frauen- und Geschlechterforschung H.2 (1998) (Neuauflage 2001), S. 7-22. Verfügbar unter: https://www.genderopen.de/bitstream/handle/25595/453/Hark_1998_Querg%C3%A4nge.pdf?sequence=1. Letzter Zugriff: 02.08.2022.Mendel, Iris (2015): WiderStandPunkte. Umkämpftes Wissen, feministische Wissenschaftskritik und kritische Sozialwissenschaften. Münster: Westfälisches Dampfboot.
Rendtorff, Barbara (2011): Stichworte und Begriffe aus der Geschlechterforschung. In: Rendtorff, Barbara/Mahs, Claudia/Wecker, Verena (Hrsg.): Geschlechterforschung. Theorien, Thesen, Themen zur Einführung. Stuttgart: Kohlhammer, S. 220-233, hier S. 224f.
Rendtorff, Barbara/Mahs, Claudia/Wecker, Verena (2011): Einleitung. In: dies. (Hrsg.), Geschlechterforschung. Theorien, Thesen, Themen zur Einführung. Stuttgart: Kohlhammer, S. 7-9.
Gender Mainstreaming wurde zunächst auf der dritten Weltfrauenkonferenz 1985 in Nairobi für die Entwicklungszusammenarbeit gefordert. Als verpflichtende Empfehlung wurde es in der Platform for Action der vierten Weltfrauenkonferenz 1995 in Beijing verankert, 1999 nahm die Europäische Union Gender Mainstreaming in den Amsterdamer Vertrag auf. Gender Mainstreaming ist in der BRD aufgrund der Unterzeichnung dieses Vertrags für Bundespolitik und Bundesverwaltung in allen Bereichen bindend (vgl. Wegrzyn 2014: Absatz 1).
Durch die Verpflichtung auf Gender Mainstreaming als gleichstellungspolitische Strategie müssen alle geplanten Maßnahmen, wie Aktionsprogramme und politische Konzepte in der Politik und in anderen Organisationen und Institutionen, vorab in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern hin untersucht und bewertet werden (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung; Stiegler 2010), womit anerkannt wird, dass Frauen und Männer weiterhin über unterschiedliche Teilhabechancen verfügen (vgl. Wegrzyn 2014: Absatz 2). Daher sind grundsätzlich die unterschiedlichen Lebenslagen und Interessen von Frauen und Männern sowie die Auswirkungen auf beide Geschlechter zu berücksichtigen. Gibt es möglicherweise illegitime negative Effekte für ein Geschlecht, dann müssen zunächst Maßnahmen zur Gleichstellung ergriffen werden (vgl. Holzleithner 2002: 143). Cordes (2010: 928) bezeichnet Gender Mainstreaming daher auch als „Gleichstellungsverträglichkeitsprüfung“.
Gender Mainstreaming stellt eine Ergänzung zu traditionellen Ansätzen der Gleichstellungspolitik dar, so dass weiterhin separate Antidiskriminierungsbestimmungen und Regelungen zur Frauenförderung existieren. Während für die Umsetzung von Gleichstellungspolitik vor allem Gleichstellungsbeauftragte zuständig sind, stellt Gender Mainstreaming Cordes (2010: 929) zufolge grundsätzlich eine „Gemeinschaftsaufgabe“ dar, die auch die politisch-administrative Ebene erfolgt sowie die Politik in Verantwortung nimmt. Voraussetzung zu einer erfolgreichen Implementierung stellt aber eine Gendersensibilität bzw. Genderkompetenz dar (vgl. ebd.), die neben Wissen über gesellschaftliche Machtverhältnisse und Strukturen vor allem Haltung und Reflexionskompetenz der beteiligten Akteur*innen erfordert. Aus diesem Grunde und u. a. aufgrund der Gefahr der Festschreibung von Geschlechterstereotypen werden vor allem von feministischer Seite immer wieder Zweifel am Erfolg dieses Konzepts geäußert – Wetterer (2005) spricht gar von einer „Redramatisierung der Geschlechterunterscheidung“ (zit. nach Stiegler 2010: 934). Zur Kritik an diesem Konzept vgl. ausführlicher Wegrzyn 2014: Absatz 3.
(Weiterführende) Literatur:
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BFFSFJ) (2021): Gender Mainstreaming. Stand: 28.12.2021. Verfügbar unter: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/gleichstellung-und-teilhabe/strategie-gender-mainstreaming/gender-mainstreaming-80436. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb): Gender-Mainstreaming. Verfügbar unter: https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/politiklexikon/17522/gender-mainstreaming/. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Cordes, Mechthild (2010): Gleichstellungspolitiken: Von der Frauenförderung zum Gender Mainstreaming. In: Becker, Ruth/Kortendiek, Beate (Hrsg.) unter Mitarbeit von Budrich, Barbara/Lenz, Ilse/Metz-Göckel, Sigrid/Müller, Ursula/Schäfer, Sabine: Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie. 3. erweiterte und durchgesehene Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft, S. 924-932.
Döge, Peter (2002): “Managing Gender“. Gender Mainstreaming als Gestaltung von geschlechterverhältnissen. APuZ 33-34/2002 [Geschlechter-Gerechtigkeit/Gender], S. 9-16. Verfügbar unter: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/26758/geschlechter-br-gerechtigkeit-gender/. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Holzleithner, Elisabeth (2002): Gender mainstreaming. In: Metzler Lexikon Gender Studies / Geschlechterforschung. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Hrsg. von Knoll, Renate. Stuttgart: J. B. Metzler, S. 142f.
Klammer, Ute (2019): Gleichstellungspolitik: wo Geschlechterforschung ihre praktische Umsetzung erfährt. In: Kortendiek, Beate/Riegraf, Birgit/Sabisch, Katja (Hrsg.): Handbuch interdisziplinäre Geschlechterforschung, Bd. 2. Wiesbaden: Springer VS, S. 983-992.
Pinl, Claudia (2002): Gender Mainstreaming – ein unterschätztes Konzept. APuZ 33-34/2002 [Geschlechter-Gerechtigkeit/Gender], S. 3-5. Verfügbar unter: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/26758/geschlechter-br-gerechtigkeit-gender/. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Rendtorff, Barbara (2011): Gender Mainstreaming [Stichworte und Begriffe aus der Geschlechterforschung]. In: Rendtorff, Barbara/Mahs, Claudia/Wecker, Verena (Hrsg.): Geschlechterforschung. Theorien, Thesen, Themen zur Einführung. Stuttgart: Kohlhammer, S. 223f.
Stiegler, Barbara (2010): Gender Mainstreaming: Fortschritt oder Rückschritt in der Geschlechterpolitik? In: Becker, Ruth/Kortendiek, Beate (Hrsg.) unter Mitarbeit von Budrich, Barbara/Lenz, Ilse/Metz-Göckel, Sigrid/Müller, Ursula/Schäfer, Sabine: Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie. 3. erweiterte und durchgesehene Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft, S. 933-938.
Wegrzyn, Eva (2014): Gender Mainstreaming. In: Gender Glossar / Gender Glossary (4 Absätze). Verfügbar unter: https://www.gender-glossar.de/post/gender-mainstreaming. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Der Ausdruck geschlechterreflektierte Sprache meint nicht nur, sich geschlechterbezogenen Formulierungen beim Schreiben und Sprechen bewusst zu werden, sondern auch, diese im alltäglichen Sprachgebrauch zu hinterfragen. Synonym zum Begriff „geschlechterreflektierte Sprache“ werden häufig auch folgende Ausdrücke verwendet: geschlechter-/gendersensible, geschlechter-/gendergerechte oder geschlechter-/genderbewusste Sprache. Der Forderung, genderreflektiert zu schreiben und zu sprechen, geht die sprachsoziologische Prämisse voraus, dass Sprache und Gesellschaft in einem komplexen Wechselwirkungsverhältnis stehen. Sprache, als ein zentraler Bestandteil von gesellschaftlicher Wirklichkeit, kann somit nicht nur Ungleichheitsstrukturen in der Gesellschaft spiegeln, sondern auch fortschreiben, oder diese brechen. An dieser Stelle knüpft die feministische Linguistik mit ihrer Sprachkritik an der ausschließlichen Verwendung des Generischen Maskulinums an. Die Fixierung auf das Generische Maskulinum im alltäglichen Sprach- und Schriftgebrauch wird als problematisch gesehen, weil es eine androzentrisch geprägte Weltanschauung, in der Man(n) als soziale Norm gesetzt wird, perpetuiert. Nicht nur Frauen würden unsichtbar gemacht werden, sondern geschlechtliche Vielfalt jenseits von Binarität würde ebenfalls negiert. Indem Sprache Einfluss auf das Bewusstsein und die Vorstellungskraft von Mitgliedern einer Gesellschaft haben kann, kann Sprache zum Medium gesellschaftlicher Ein- und Ausschlussmechanismen werden, und somit nicht „bloß“ zu Diskriminierung in Wort und Schrift führen. Mit der Verwendung genderreflektierter Formulierungen beim Schreiben und Sprechen geht somit auch die Forderung nach (sprachlicher) Geschlechtergerechtigkeit einher. Aufgrund der vielfältigen Diskriminierungen, die aus der Verwendung des generischen Maskulinums resultieren können, haben bereits viele Hochschulen und auch andere Einrichtungen Leitfäden entwickelt, die aufzeigen, wie sich diskriminierungsfreies und genderumfassendes Schreiben und Sprechen gestalten lassen kann.
Beispiele für Leitfäden:
- Projekt Genderleicht.de. Website des Journalistinnenbundes (2020)
- ÜberzeuGENDERe Sprache. Leitfaden für eine geschlechtersensible Sprache der Universität zu Köln (2020)
- Sprache ist vielfältig. Leitfaden der HU Berlin für geschlechtergerechte Sprache (2019)
Im Übrigen werden einige Formulierungsbeispiele aufgeführt:
- Neutrale Formulierungen: Vielfach ist es möglich, die männliche Form durch geschlechtsneutrale Oberbegriffe zu ersetzen, wie z. B. mithilfe eines substantivierten Adjektivs: die Studierenden, die Mitarbeitenden, die Antragstellenden etc., oder statt der Person die Sache zu bezeichnen: z. B. die Teilnahmebegrenzug statt die Teilnehmerbegrenzung.
- Paarformulierungen/Beidnennung: Zugleich ist es möglich, Frauen explizit anzusprechen oder sowohl Männer als auch Frauen zu adressieren: „Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer“.
- Großschreibung des Binnen-I`s und von ‚R‘ und ‚N‘: z. B. MitarbeiterInnen statt „Mitarbeiter“, jedeR statt „jeder“, eineN BeschäftigteN statt „einen Beschäftigten“.
- Schrägstrich/Slash: Etabliert hat sich u.a. die Trennung der weiblichen und männlichen Form durch das Slash-Zeichen: z.B. Mitarbeiter/innen oder Mitarbeiter-/innen, Schüler-/innen oder Schüler/innen.
- Unterstrich (Gender Gap) _ oder Asterix (Gendersternchen) *: Eine Sprache, die sich ausschließlich auf Frauen und Männer, d. h. auf eine sog. ,Kultur der Zweigeschlechtlichkeit‘ bezieht, ist immer noch diskriminierend für all diejenigen Menschen, die nicht in dieses Muster passen und keine eindeutige Geschlechtsidentität leben. Um diese Heteronormativität zu umgehen, hat es sich insbesondere in den Queer Studies und der Geschlechterforschung etabliert, den Unterstrich zu verwenden oder mit Sternchen zu schreiben: die Schüler_innen oder Schüler*innen. Schweden hat darüber hinaus ein drittes Personalpronomen verabschiedet, was ‚er‘ (han) und ‚sie‘ (hon) um ‚hen‘ erweitert.
- Doppelpunkt :: Wie auch das Gendersternchen oder der Unterstrich steht der Doppelpunkt für geschlechtliche Vielfalt: die Student:innen.
(Weiterführende) Literatur:
Günther, Susanne (2019): Sprachwissenschaft und Geschlechterforschung: Übermittelt unsere Sprache ein androzentrisches Weltbild? In: Kortendiek, Beate/Riegraf, Birgit/Sabisch, Katja (Hrsg.), Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung. Wiesbaden: Springer VS, S. 571-589.
Hornscheidt, Lann (2012): feministische w_orte. ein lern-, denk- und handlungsbuch zu sprache und diskriminierung, gender studies und feministischer linguistik. Frankfurt a. M.: Brandes & Apsel.
Nübling, Damaris (2020). ÜberEmpfindlichkeiten? Die Geschlechter in der Sprache. In: Rendtorff, Barbara/Mahs, Claudia/Warmuth, Anne-Dorothee (Hrsg.): Geschlechterverwirrungen. Was wir wissen, was wir glauben und was nicht stimmt. Frankfurt/New York: Campus, S. 82-89.
Rendtorff, Barbara (2011). Geschlechterregerechte (geschlechterbewusste) Sprache [Stichworte und Begriffe aus der Geschlechterforschung]. In: Rendtorff, Barbara/Mahs, Claudia/Wecker, Verena (Hrsg.): Geschlechterforschung. Theorien, Thesen, Themen zur Einführung. Stuttgart: Kohlhammer, S. 225.
Als Gläserne Decke (engl. glass ceiling) wird eine nicht sichtbare Barriere bezeichnet, mit der Frauen aufgrund von strukturellen und ideologischen Ursachen im Karriereverlauf trotz hoher Qualifikation häufig dann konfrontiert sind, wenn sie in das obere Management aufsteigen wollen, während männlichen Kollegen mit vergleichbarer Qualifikation dieser Aufstieg in der Regel ,gelingt‘. Ursachen werden neben dem fehlenden Zugang zu informellen Netzwerken erstens und vor allem in stereotypen Rollenvorstellungen gesehen, demnach Frauen aufgrund familiärer Verpflichtungen und bestimmter, ihnen zugeschriebener Eigenschaften – wie etwa einer starken Emotionalität – angeblich weniger für entsprechende Tätigkeiten geeignet sind. Zweitens stellt das Fortbestehen häufig rein homosozialer Männergemeinschaften, von denen Frauen strukturell ausgeschlossen sind, einen weiteren relevanten Faktor dar. Aus diesem Grunde hat der Bundestag 2015 die Einführung einer Frauenquote gebilligt, die langfristig zum Anstieg des Frauenanteils in Führungspositionen in der Privatwirtschaft sowie im öffentlichen Dienst beitragen soll.
(Weiterführende) Literatur:
Beaufaÿs, Sandra (2012): Führungspositionen in der Wissenschaft – Zur Ausbildung männlicher Soziabilitätsregime am Beispiel von Exzellenzeinrichtungen. In: Beaufaÿs, Sandra/Engels, Anita/ Kahlert, Heike (Hrsg.): Einfach Spitze? Neue Geschlechterperspektiven auf Karrieren in der Wissenschaft. Frankfurt a. M.: Campus Verlag, S. 87-117.
Müller, Ursula (2013): Zwischen Licht und Grauzone: Frauen in Führungspositionen. In: Müller, Ursula/Riegraf, Birgit/Wilz, Sylvia M. (Hrsg.): Geschlecht und Organisation. Wiesbaden: Springer VS, S. 469-494.
Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in der Bundesrepublik Deutschland im Grundgesetz (GG), Art. 3, Abs. 2 geregelt. Dort heißt es: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ Weiterhin gibt das im darauffolgenden Abs. 3 festgehaltene Diskriminierungsverbot vor: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes […] benachteiligt oder bevorzugt werden.“ Gleichberechtigung bzw. Gleichstellung meint also, dass Frauen und Männer bei gleichen Voraussetzungen auch gleiche Rechte haben müssen (vgl. Kahlert 2002: 164). Zur Implementierung dieses Rechts gibt es seit den 1980er Jahren – bis dahin gab es auf rechtlicher Ebene zum Teil noch massive Diskriminierungen von Frauen, indem etwa Ehemänner bis 1977 über eine Berufstätigkeit ihrer Ehefrau entscheiden durften – Gleichstellungsgesetze und -beauftragte, Frauenförderpläne etc., die seit Ende der 1990er um Gender Mainstreaming-Maßnahmen erweitert werden (vgl. ebd.).
Cordes (2010: 924) fasst die Ziele von Gleichstellungspolitik wie folgt zusammen: (1) Aufhebung von Diskriminierungen gegenüber Frauen als Folge ungleicher Lebensverhältnisse von Frauen und Männern; (2) Beseitigung der sozialen Folgen dieser Ungleichheiten im Sinne gleicher gesellschaftlicher Lebenschancen und Teilhabemöglichkeiten. Dabei unterscheidet sie zwischen drei Formen von Diskriminierung (vgl. ebd.):
- Unmittelbare Diskriminierung meint, dass Frauen durch bestimmte Rechtslagen direkt als Gruppe diskriminiert werden; etwa wenn es Frauen lange Zeit untersagt war, ohne Zustimmung des Mannes ein eigenes Konto zu eröffnen.
- Mittelbare Diskriminierung bedeutet, dass ein Geschlecht im Vergleich zum anderen durch eine eigentlich geschlechtsneutrale Norm mittelbar diskriminiert wird. Cordes (2010) nennt hier als Beispiel die rechtlichen Nachteile von Teilzeit- im Vergleich zu Vollzeitbeschäftigten, von denen Frauen in besonders großem Maße betroffen sind (vgl. ebd.: 924).
- Strukturelle Diskriminierung bezeichnet Nachteile für eine Bevölkerungsgruppe, die aus gesellschaftlich geteilten Normen bzw. Regelsystemen resultieren und im Denken und Handeln vieler Menschen verankert sind. Bspw. bringt die Vorstellung, dass tendenziell eher Frauen für Reproduktionsarbeiten innerhalb der Familie hauptverantwortlich sind, in der Regel Nachteile für deren berufliche Karriere mit sich.
Zwar gibt es derzeit kaum noch Formen unmittelbarer Diskriminierung, da Frauen jedoch nach wie vor in vielen Gesellschaftsbereichen im Vergleich zu Männern mittelbar wie strukturell benachteiligt sind, setzt Gleichstellungspolitik daher im Besonderen auf Frauenförderung und hat nach Cordes (2010: 927) folgende Ziele:
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf – diese betrifft auch Väter,
- Unterstützung von Frauen beim Zugang zu sog. Männerdomänen,
- wie auch die Erhöhung des Anteils von Frauen auf Ebene von Führungspositionen, zu deren Zweck die Frauenquote vom Bundestag beschlossen wurde.
Entsprechend wird auch im Landesgleichstellungsgesetz Nordrhein Westfalen, § 1, geregelt, dass alle bestehenden Benachteiligungen von Männern und Frauen abzubauen und Frauen besonders zu fördern sind sowie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht werden muss. Weiterhin regelt das Gesetz, dass Personen aufgrund ihrer Geschlechtsidentität nicht diskriminiert werden dürfen und Maßnahmen keine negativen Benachteiligungen auf eine Geschlechtsgruppe haben dürfen.
(Weiterführende) Literatur:
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2022): Stark für die Zukunft. Die Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung. Stand: Juli 2020. Verfügbar unter: https://www.gleichstellungsstrategie.de/. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2018): Zweiter Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. 20.12.2018. Verfügbar unter: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/zweiter-gleichstellungsbericht-119796. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Bundesministerium der Justiz (BMJ): Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Verfügbar unter: http://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Cordes, Mechthild (2010): Gleichstellungspolitiken: Von der Frauenförderung zum Gender Mainstreaming. In: Becker, Ruth/Kortendiek, Beate (Hrsg.) unter Mitarbeit von Budrich, Barbara/Lenz, Ilse/Metz-Göckel, Sigrid/Müller, Ursula/Schäfer, Sabine: Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie. 3. erweiterte und durchgesehene Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft, S. 924-932.
Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen: Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG) mit Stand vom 16.07.2022. Verfügbar unter: https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=220071121100436242. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Kahlert, Heike (2002): Gleichberechtigung/Gleichstellung. In: Metzler Lexikon Gender Studies / Geschlechterforschung. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Hrsg. von Knoll, Renate. Stuttgart: J. B. Metzler, S. 164.
Klammer, Ute (2019): Gleichstellungspolitik: wo Geschlechterforschung ihre praktische Umsetzung erfährt. In: Kortendiek, Beate/Riegraf, Birgit/Sabisch, Katja (Hrsg.): Handbuch interdisziplinäre Geschlechterforschung, Bd. 2. Wiesbaden: Springer VS, S. 983-992.
Dieser Begriff bezeichnet die Kritik an einer Kultur der heterosexuellen Zweigeschlechtlichkeit, d.h. an der Vorstellung, dass sich alle Gesellschaften einzig und allein in zwei einander begehrende Geschlechter unterteilen, dass dies immer so war und dass Geschlecht etwas ist, das von den Individuen niemals abgelegt werden kann (vgl. Hirschauer 1994; Wetterer 2010: 127). So besteht in der Regel ein „Ausweiszwang“ (Hirschauer 2001: 215) von Geschlecht, der impliziert, dass das (als biologisch angesehene) Körpergeschlecht mit der Geschlechtsidentität, also der Identifizierung einer Person als weiblich oder männlich (etwa durch Kleidung, Auftreten, Vorlieben u. Ä.), und dem sexuellen Begehren als heterosexuell, sprich auf das jeweils ‚andere‘ Geschlecht bezogen, kongruiert – Judith Butler (1991) spricht hierbei von der sogenannten „heterosexuellen Matrix“. Das Konzept schließt daher die Kritik an den sich daraus ergebenden normierenden und diskriminierenden Heterosexualitätsanforderungen (und -zwängen) und dem Anspruch auf Eindeutigkeit von Geschlechtskörper und -identität, der immer auch Verluste hervorbringt, mit ein.
(Weiterführende) Literatur:
Butler, Judith (1991): Das Unbehagen der Geschlechter [orig. Gender Trouble, 1990]. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Butler, Judith (1995): Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Hartmann, Jutta et al. (2007): Heteronormativität. Empirische Studien zu Geschlecht, Sexualität und Macht. Wiesbaden: Springer.
Hirschauer, Stefan (1994): Die soziale Fortpflanzung der Zweigeschlechtlichkeit. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 46, S. 668-692.
Hirschauer, Stefan (2001): Das Vergessen des Geschlechts: Zur Praxeologie einer Kategorie sozialer Ordnung. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (Sonderheft 41); S. 208-235.
Wetterer, Angelika (2010). Konstruktion von Geschlecht. Reproduktionsweisen der Zweigeschlechtlichkeit. Becker, Ruth/Kortendiek, Beate (Hrsg.) unter Mitarbeit von Budrich, Barbara/Lenz, Ilse/Metz-Göckel, Sigrid/Müller, Ursula/Schäfer, Sabine: Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie. 3. erweiterte und durchgesehene Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 126-136.
Intersektionalität beschreibt Lenz (2010) als ein „Bündel theoretischer Ansätze“, mit denen „das Wechselverhältnis von Geschlecht und weiteren sozialen Ungleichheiten“ (ebd.: 158) erfasst werden soll. Der Begriff der Intersektionalität wurde im Jahr 1989 von Kimberlé Crenshaw, einer afroamerikanischen Juristin, entwickelt, um die interdependenten Einflüsse verschiedener sozialer Ungleichheiten zu verdeutlichen (vgl. ebd.). Das Bild der intersection als Straßenkreuzung eignet sich dabei, um die „Verwobenheit und das Zusammenwirken verschiedener Differenzkategorien sowie unterschiedlicher Dimensionen sozialer Ungleichheit“ (Thiessen 2010: 41) aufzuzeigen. Während seit den 1970er Jahren zunächst Kategorien wie sex, class und race im Vordergrund standen, hat sich die Wahrnehmung von Unterschieden entlang dieser Ungleichheitsdimensionen mittlerweile erweitert (vgl. Lenz 2010: 158), so dass auch Kategorien wie desire, religion, disability und age in den Blick geraten sind, die immer weiter ausdifferenziert werden. Der Intersektionalitätsansatz hat dabei das Ziel, zu verdeutlichen, „dass sich Formen der Unterdrückung und Benachteiligung nicht additiv aneinander reihen lassen, sondern in ihren Verschränkungen und Wechselwirkungen zu betrachten sind“ (Küppers 2014: Absatz 1) und zum Teil Ungleichheiten auf unterschiedlichen Ebenen bedingen: Während Geschlecht etwa vor allem Verhältnisse im intimen Nahraum – etwa in der Familie – sowie auf Ebene der gesellschaftlichen Arbeitsteilung organisiert, bestimmt class die Arbeitsteilung innerhalb des Produktionsbereichs (vgl. Verloo 2006: 217, zit. nach Lenz 2010: 160). Eine grundlegende Frage ist, ob es sich bei den verschiedenen Kategorien eher um Strukturkategorien, wie etwa class und race handelt, oder vielmehr um Differenzkategorien, wie age und disability, die zu Benachteiligungen in unterschiedlichsten Zusammenhängen führen können. Dies würde eine unendliche Erweiterbarkeit der Kategorien bedingen. (Vgl. Lenz 2010: 159) Daher wird oftmals zwischen verschiedenen Analyseebenen differenziert, auf denen Intersektionalität untersucht werden kann (vgl. ausführlicher ebd.: 160ff.). Kritik wird insbesondere an der theoretischen Fundierung des Ansatzes geübt (Knapp 2005; 2017) oder auch an der verschiedenen Ansätzen und Ansprüchen (Zander 2017).
(Weiterführende) Literatur:
Knapp, Gudrun-Axeli (2005): Intersectionality - ein neues Paradigma feministischer Theorie? Zur transatlantischen Reise von "Race, Class, Gender". In: Feministische Studien, Jg. 23, Heft 1, S. 68-81.
Knapp, Gudrun-Axeli (2017): Intersektionalität und das Problem epistemischer Pfadabhängigkeit. In: Psychologie & Gesellschaftskritik, Jg. 41; Heft 2, S. 7-24.
Küppers, Carolin (2014): Intersektionalität. In: Gender Glossar/Gender Glossary. (5 Absätze). Verfügbar unter: gender-glossar.de (letzter Zugriff: 14.06.2015).
Lenz, Ilse (2010): Intersektionalität: Zum Wechselverhältnis von Geschlecht und sozialer Ungleichheit. In: Becker, Ruth/Kortendiek, Beate (Hg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie. 3. erweiterte und durchgesehene Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft, S. 158-165.
Thiessen, Barbara (2010): Feminismus: Differenzen und Kontroversen. In: Becker, Ruth/Kortendiek, Beate (Hrsg.) unter Mitarbeit von Budrich, Barbara/Lenz, Ilse/Metz-Göckel, Sigrid/Müller, Ursula/Schäfer, Sabine: Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie. 3. erweiterte und durchgesehene Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft, S. 37-44.
Winker, Gabriele/Degele, Nina (2010): Intersektionalität. Zur Analyse sozialer Ungleichheiten. 2. unveränderte Auflage. Bielefeld: transcript.
Zander, Michael (2017): Was ist problematisch an Intersektionalität? In: Psychologie & Gesellschaftskritik, Jg. 41; Heft 2, S. 47-65.
Unter Intergeschlechtlichkeit versteht man allgemein die körperliche Verfasstheit von Menschen, „deren geschlechtlich attribuierte Merkmale wie Chromosomen, Gonaden, Hormone und das äußere Genital von Geburt an nicht eindeutig in das binäre System von männlich und weiblich einzuordnen sind“ (Krämer/Sabisch 2019: 1213-1214). Innerhalb des Sammelbegriffs „Intergeschlechtlichkeit“ gibt es verschiedene Variationen von Körperausprägungen, daher wird auch von Varianten der Geschlechtsentwicklung gesprochen. Intergeschlechtliche Menschen können sich – ebenso wie endogeschlechtliche Menschen – als weiblich, männlich, trans* oder nichtbinär (enby) definieren oder auch als intergeschlechtlich. Die Intergeschlechtlichkeit sagt nichts über das Begehren oder die sexuelle Orientierung eines Menschen aus.
Bis in die heutige Zeit wurden insbesondere intergeschlechtliche Kinder mit einem Genital, welches nicht der typisch weiblichen oder typisch männlichen Norm entspricht, chirurgisch und/oder hormonell zugewiesen. Seit 2021 dürfen nicht medizinisch indizierte Operationen nur noch mit der informierten Einwilligung der davon betroffenen Person durchgeführt werden (vgl. BGB §1631e). Seit 2018 ist es möglich neben der Offenlassung des Geschlechtseintrags oder der Bezeichnung ‚weiblich‘ oder ‚männlich‘ auch ‚divers‘ als Personenstand eintragen zu lassen.
(Weiterführende) Literatur:
Bürgerliches Gesetzbuch (2021): § 1631e Behandlung von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung. Online unter: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1631e.html (Zugriff 03.05.2022)
Groß, Melanie/Niedenthal, Katrin (Hrsg.) (2021): Geschlecht Divers. Die „Dritte Option“ im Personenstandsgesetz – Perspektiven für die Soziale Arbeit. Bielefeld: transcript.
Haller, Paul/Pertl, Luan/Ponzer, Tinou (2022): Inter* Pride. Perspektiven aus einer weltweiten Menschenrechtsbewegung. Hiddensee: W_orten & meer.
Klöppel, Ulrike (2010): XXOXY ungelöst. Hermaphroditismus, Sex und Gender in der deutschen Medizin. Bielefeld: transcript.
Krämer, Anike/Sabisch, Katja (2019): Inter*: Geschichte, Diskurs und soziale Praxis aus Sicht der Geschlechterforschung. In: Kortendieck, Beate; Riegraf, Birgit; Sabisch, Katja (Hrsg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung. Wiesbaden: Springer. S. 1213-1222.
Mader, Esto et al. (Hrsg.) (2021): Trans* und Inter* Studies. Aktuelle Forschungsbeiträge aus dem deutschsprachigen Raum. Münster: Westfälisches Dampfboot. https://inter-nrw.de/
Das Kaskadenmodell wurde für die Wissenschaft entwickelt und wurde auch bei der Formulierung der Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) berücksichtigt: „Die DFG Mitgliederversammlung verabschiedete im Jahr 2008 mit großer Mehrheit die Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG. Dabei vereinbarten die Mitgliedseinrichtungen im Rahmen einer Selbstverpflichtung Standards, um der unzureichenden Beteiligung von Frauen in der Wissenschaft entgegenzuwirken und eine signifikante Steigerung der Frauenanteile auf allen Karrierestufen des deutschen Wissenschaftssystems zu erreichen.“ (DFG 2017: 18). „Das Kaskadenmodell basiert auf der Idee, dass sich die Zielwerte auf jeder Karrierestufe [an den Hochschulen] an den Istwerten der darunter liegenden Karrierestufe orientieren sollten“ (DFG 2017: 15). Dabei zeigt sich der Erfolg von Gleichstellung vor allem daran, wie Frauen und Männern auf den jeweiligen Qualifizierungsstufen anteilig vertreten sind.
„In seinen Empfehlungen zur Chancengleichheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Jahre 2007 hat der Wissenschaftsrat aus diesem Befund insgesamt gesehen den Schluss gezogen, dass die Berufungswahrscheinlichkeit von Frauen aufgrund unklarer Qualifikationsdefinitionen und eines GenderBias in der Bewertung wissenschaftlicher Exzellenz negativ beeinträchtigt sein kann. Darüber hinaus weist der Wissenschaftsrat darauf hin, dass bei der Besetzung einer Professur insbesondere das als wirkmächtig eingestufte Entscheidungskriterium der ‚Passfähigkeit‘ in das künftige Arbeitsumfeld, über das in aller Regel männlich dominierte Berufungskommissionen entscheiden, in erster Linie negative Auswirkungen für den Erfolg weiterer Bewerbungen zeigt.“ (MKW 2014: 4) Für Berufungsverfahren hat die Landesregierung in NRW das Kaskadenmodell daher bereits in das Hochschulzukunftsgesetz aufgenommen.
Als Berechnungsgrundlage dient der absolute Anteil von Frauen auf einer Karrierestufe in Relation zum Frauenanteil auf der jeweils vorherigen Karrierestufe, auf Grundlage derer schließlich eine auf dem Frauenanteil der vorhergehenden Qualifizierungsstufe basierende Quote errechnet wird. Letztere führt dann zur Errechnung einer „Zielquote“ (ebd.: 5), die von der Hochschule in einem eigens definierten Zeitraum umzusetzen ist.
Fällt in einem Fach bzw. auf einer Qualifizierungsstufe ein besonders starkes Absinken des Frauenanteils im Vergleich zur vorherigen Stufe auf (leaky pipeline), so sind im Rahmen einer nachhaltigen Gleichstellungsarbeit geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die den Anteil erhöhen bzw. zu einer Parität beitragen. Sind die Absolvent*innen eines Fachs z. B. zu über 70 Prozent weiblich, auf Ebene der Promotionen liegt ihr Anteil noch auf 40 Prozent, auf Ebene der Professuren jedoch nur auf 10 Prozent, dann sind im Rahmen des Kaskadenmodells Ursachen für den zunehmend geringeren Frauenanteil herauszufinden und entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
(Weiterführende) Literatur:
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (2020): Die „Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards“ der DFG: Zusammenfassung und Empfehlungen 2020. Stand: 30. Juni 2020. Verfügbar unter: https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/grundlagen_dfg_foerderung/chancengleichheit/fog_empfehlungen_2020.pdf. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (2017): Die Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards Der DFG: Umsetzung und Wirkungsweisen. Stand: 24.11.2017. Verfügbar unter: https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/geschaeftsstelle/publikationen/studien/studie_gleichstellungsstandards.pdf. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Hendrix, Ulla (2019): Frauenquote: zwischen Legitimität, Effizienz und Macht. In: Kortendiek, Beate/Riegraf, Birgit/Sabisch, Katja (Hrsg.): Handbuch interdisziplinäre Geschlechterforschung, Bd. 2. Wiesbaden: Springer VS, S. 993-1002.
Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (MKW) (2014): Das Kaskadenmodell des nordrhein-westfälischen Hochschulgesetzes in der Hochschulpraxis. Düsseldorf Oktober 2014. Verfügbar unter: https://www.mkw.nrw/sites/default/files/media/document/file/abhandlung_kaskadenmodell_-_e1.pdf. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Mit dem Begriff der Leaky Pipeline wird der in der Wissenschaft absinkende Frauenanteil auf den verschiedenen Qualifizierungsebenen und Karrierestufen bezeichnet, der in vielen Fachbereichen trotz zunehmend höherer Bildungsabschlüsse von Mädchen und Frauen, Frauenförderplänen, Gleichstellungspolitiken, Gender Mainstreaming-Maßnahmen und gezielter Angebote im MINT-Bereich sowie von Mentoring-Programmen immer noch zu verzeichnen ist und auf eine fortbestehende strukturelle Ungleichheit von Männern und Frauen hinweist.
(Weiterführende) Literatur:
Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) (2021): „Leaky Pipeline“ an den Hochschulen besteht EU-weit – U-Multirank startet neuen „Gender Monitor“. Verfügbar unter: https://www.che.de/2021/leaky-pipeline-an-den-hochschulen-besteht-eu-weit-u-multirank-startet-neuen-gender-monitor/. Letzter Zugriff: 02.08.2022.
Schlüter, Anne (2019): Mentoring: Instrument einer gendergerechten akademischen Personalentwicklung. In: Kortendiek, Beate/Riegraf, Birgit/Sabisch, Katja (Hrsg.): Handbuch interdisziplinäre Geschlechterforschung, Bd. 2. Wiesbaden: Springer VS, S. 1023-1032.
Bei Männlichkeitenforschung, auch als Men’s Studies oder seltener als Männerforschung bezeichnet, handelt es sich um einen Forschungsbereich der Gender Studies/Geschlechterforschung, der danach fragt, wie Männlichkeit bzw. männliche Identität(en) konstruiert werden (vgl. Vahsen 2002a: 248). Dementsprechend findet auch eine intensive Auseinandersetzung mit männlichen Lebenswelten statt, die sich sowohl auf erwachsene Männer als auch auf Kinder und insbesondere Jugendliche bezieht.
Nachdem die Zweite Frauenbewegung jahrelang Kritik an der fehlenden Auseinandersetzung mit Frauen und weiblichen Lebenswelten geäußert hatte und es ihr gelungen war, diese zum Gegenstand von Forschung zu machen sowie in das öffentliche Bewusstsein zu rücken, forderte sie auch eine stärkere Beschäftigung mit männlichen Lebenswelten samt der ihnen inhärenten Unterschiede und Widersprüche. So wurde lange Zeit von Männlichkeit als einem monolitischen Block ausgegangen – der Mann galt stattdessen „als Repräsentant des, schlechthin Allgemeine[n]‘ (Simmel, 1985, S. 214)“ (Scholz 2015: Absatz 1).
Für die in Deutschland erst in den 1990er Jahren verspätet Einzug haltende Männlichkeitsforschung war zudem die in den 1970er/80er Jahren innerhalb des anglo-amerikanischen Raums einsetzende Entwicklung bedeutsam: Dort formulierten zu einer Bewegung angewachsene heterosexuelle und schwule Männergruppen Kritik an den als unzureichend wahrgenommenen dominierenden Männlichkeitsbildern. Entsprechend standen zunächst männliche Identitäten und Erfahrungswelten im Vordergrund des Interesses. Die ab den 1990er Jahren zunehmende Auseinandersetzung mit geschlechtertheoretischen Grundlagen, feministischer Männerforschung sowie den Gay-Studies führte jedoch zu einer Veränderung der methodologischen Herangehensweisen sowie zur Wahrnehmung der Pluralität bzw. Vielfalt männlicher Existenzweisen. (Vgl. Vahsen 2002a: 248)
Insbesondere der von Carrigan, Connell und Lee (1996) formulierte Aufsatz Ansätze zu einer neuen Soziologie der Männlichkeit (Engl. Toward a New Sociology of Masculinity, 1985) und Connells Ausführungen zu Gender and Power (Dt. Der gemachte Mann, 1999) hatten auf die Theorieentwicklung der Männlichkeitsforschung großen Einfluss. Das zunächst von Carrigan, Connell und Lee formulierte Konzept der hegemonialen Männlichkeit stellt auch heute – trotz Kritik vor dem Hintergrund sich transformierender gesellschaftlicher (Geschlechter-)Verhältnisse – einen grundlegenden Ansatz dar, der stetig weiterentwickelt wird (vgl. Meuser 2010; Scholz 2019). In der mittlerweile ein Standardwerk der Geschlechter- und Männlichkeitsforschung darstellenden Weiterentwicklung des Konzeptes der hegemonialen Männlichkeit von Connell (Gender and Power) befasst sie sich mit der Relation von patriarchalen Strukturen und damit einhergehenden Machtkonstellationen und zeigt dabei – und hierin besteht der Mehrwert ihrer Theorie – ein doppeltes Unterdrückungsverhältnis auf (vgl. u. a. Vahsen 2002a: 248): das von Männern gegenüber Frauen sowie das zwischen Männern untereinander. Connell (1999) unterscheidet insgesamt vier Handlungspraxen von Männlichkeit bzw. Männlichkeitskonzepte: (1) die hegemoniale, d. h. die herrschende und innerhalb von einem historischen wie kulturellen Kontexten milieuübergreifend akzeptierte Form von Männlichkeit – dieser sind alle anderen Männlichkeitsentwürfe untergeordnet –, (2) die komplizenhafte Männlichkeit, die in Form der „patriarchalen Dividende“ von der Macht derjenigen Männer profitiert, die die hegemoniale Männlichkeit verkörpern, sowie (3) untergeordnete und (4) marginalisierte Männlichkeiten. Während als marginalisiert vor allem solche Männlichkeitsentwürfe gelten, die – etwa aufgrund von Ethnizität – nur bedingt von den aus dem Patriarchat hervorgehenden Vorteilen profitieren, zählt Connell zur untergeordneten Männlichkeit vor allem homosexuelle Männer. Aufgrund der ihnen zugeschriebenen Nähe zur Weiblichkeit gelten sie (ähnlich wie Frauen) als untergeordnet. Dennoch zeigen sich immer wieder Überlappungen zwischen diesen vier Kategorien, die vom gesellschaftlichen Wandel nicht unangetastet bleiben.
Ein Fokus in der internationalen Forschung zu Männlichkeiten richtet sich in den letzten Jahren etwa u. a. auf Männlichkeitsentwürfe im transnationalen Kontext: „Connell (1998) vertritt die These, dass derzeit die älteren, lokalen, in den lokalen herrschenden Klassen und konservativen Kulturen verankerten Modelle von bürgerlicher Männlichkeit [im deutsprachigen Raum wäre das etwa das auf dem Normalarbeitsverhältnis basierende Ernährermodell, Erg. d. d. A.] von einer transnationalen Männlichkeit abgelöst werden, deren Modell der Geschäftsmann ist. Verglichen mit den älteren hegemonialen Männlichkeiten ist diese Männlichkeit individualistischer, ,liberaler‘ in Bezug auf Sexualität und soziale Einstellungen und eher an Macht durch Marktbeherrschung orientiert als an bürokratischer Macht.“ (Wedgwood/Connell 2010: 120) Auch ist zu diskutieren, ob Frauen mittlerweile eine der hegemonialen Männlichkeit vergleichbare Form hegemonialer Weiblichkeit verkörpern können (vgl. dazu Scholz 2010; kritisch: Stückler 2013).
Ähnlich wie die Theorie Connells ist auch diejenige Pierre Bourdieus zur männlichen Herrschaft nach Meuser (2001) – ihm ist v. a. die Verbindung beider Theorien zu verdanken (vgl. Meuser 2006) – durch eine „doppelte Distinktions- und Dominanzstruktur“ (Meuser 2001: 7) gekennzeichnet: der Unterordnung von Frauen sowie dem Bedürfnis nach der Dominanz über andere Männer (vgl. ebd.). Während Connell den Fokus aber v. a. auf die Beziehungen der Männer untereinander richtet, fokussiert Bourdieu primär Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen. Ihm zufolge wird der männliche Habitus „[k]onstruiert und vollendet […] nur in Verbindung mit dem den Männern vorbehaltenen Raum, in dem sich, unter Männern, die ernsten Spiele des Wettbewerbs abspielen […]“ (Bourdieu 1997: 203). Frauen sind von diesen ernsten Spielen zwar ausgeschlossen, können jedoch dazu beitragen, das symbolische Kapital der Männer innerhalb der sog. Spiele (bspw. durch ihr Äußeres) zu steigern.
Die Männlichkeitenforschung ist mittlerweile neben der Soziologie in vielen anderen Disziplinen wie der Erziehungswissenschaft, der Literaturwissenschaft, der Geschichtswissenschaft oder auch der Gesundheitswissenschaft vertreten. Gemeinsame Themenschwerpunkte sind nach Vahsen (2002a: 249) u. a.: die männliche Sozialisation, Jungenforschung, Gewalt, männliche Sexualität, Männlichkeit und Arbeit, Männlichkeiten in Organisationen, Männergesundheit und Männergeschichte; in den letzten Jahren ist insbesondere die Auseinandersetzung mit Fragen von Männlichkeit, Vaterschaft und Väterlichkeit zu einem breiten Forschungsfeld avanciert (vgl. exempl. Meuser/Scholz 2012). Zu unterschiedlichen Strängen und Ansätzen der Männlichkeitenforschung sowie deren Schwerpunkten und Zielsetzungen siehe exemplarisch Vahsen 2002a: 249 und – mit Fokus auf den internationalen Kontext – Wedgwood/Connell 2010.
(Weiterführende) Literatur:
Bourdieu, Pierre (1997): Die männliche Herrschaft. In: Dölling, Irene/Krais, Beate (Hrsg.): Ein alltägliches Spiel. Geschlechterkonstruktion in der sozialen Praxis. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 153-217.
Brod, Harry (Hrsg.) (1987): The making of masculinities: the new men's studies. London: Allen & Unwin.
Brod, Harry/Kaufman, Michael (Hrsg.) (1994): Theorizing masculinities. Thousand Oaks u.a.: Sage Publ.
Carrigan, Tim/Connell, Robert W./Lee, John (1996): Ansätze zu einer neuen Soziologie der Männlichkeit. In: BauSteineMänner (Hrsg.): Kritische Männerforschung. Neue Ansätze in der Geschlechtertheorie. Hamburg: Argument-Verlag, S. 38-75.
Connell, Robert W. (1987): Gender and power: society, the person and sexual politics. Stanford Calif.: Stanford Univ. Press.
Connell, Robert W. (1999): Der gemachte Mann: Konstruktion und Krise von Männlichkeiten. Hrsg. von Müller, Ursula, übers. von Stahl, Christian. In: Geschlecht und Gesellschaft, Bd. 8, Opladen: Leske + Budrich.
Horlacher, Stefan/Jansen, Bettina/Schwanebeck, Wieland (2016): Männlichkeiten. Ein interdisziplinäres Handbuch. Heidelberg: J.B. Metzler.
Meuser, Michael (2001): Männerwelten. Zur kollektiven Konstruktion hegemonialer Männlichkeit. In: Schriften des Essener Kollegs für Geschlechterforschung. Hrsg. von Janshen, Doris/Meuser, Michael. 1. Jg., Heft II, S. 5-32.
Meuser, Michael (2006): Geschlecht und Männlichkeit. Soziologische Theorie und kuzlturelle Deutungsmuster. 2., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Meuser, Michael (2010): Geschlecht, Macht, Männlichkeit – Strukturwandel von Erwerbsarbeit und hegemoniale Männlichkeit, S. 325-336. – Replik: Hegemoniale Männlichkeit – ein Auslaufmodell? In: Erwägen, Wissen, Ethik (EWE) 21, H. 3, S. 415-431.
Meuser, Michael/Scholz, Sylka (2012): Herausgeforderte Männlichkeiten. Männlichkeitskonstruktionen im Wandel von Erwerbsarbeit und Familie. In: Baader, Meike/Bilstein, Johannes/Tholen, Toni (Hrsg.): Erziehung, Bildung und Geschlecht. Männlichkeiten im Fokus der Gender-Studies. Wiesbaden: Springer VS, S. 23-40.
Scholz, Sylka (2010): Hegemoniale Weiblichkeit? Hegemoniale Weiblichkeit! In: Erwägen. Wissen. Ethik Jg. 21, S. 396-398.
Scholz, Sylka (2015): Männlichkeit in der Soziologie. In: Gender Glossar / Gender Glossary (5 Absätze). Verfügbar unter: gender-glossar.de
Scholz, Sylka (2019): Männlichkeitsforschung: die Hegemonie des Konzeptes „hegemoniale Männlichkeit“. In: Kortendieck, Beate; Riegraf, Birgit; Sabisch, Katja (Hrsg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung. Wiesbaden: Springer.
Stückler, Andreas (2013): Auf dem Weg zu einer hegemonialen Weiblichkeit? Geschlecht, Wettbewerb und die Dialektik der Gleichstellung. In: Gender, Heft 3 (2013), S. 114-130.
Vahsen, Mechthilde (2002a): Männerforschung (Men’s Studies/New Men’s Studies/Men’s Movement). In: Metzler Lexikon Gender Studies / Geschlechterforschung. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Hrsg. von Knoll, Renate. Stuttgart: J. B. Metzler, S. 248f.
Vahsen, Mechthilde (2002b): Männerforschung, feministische. In: Metzler Lexikon Gender Studies / Geschlechterforschung. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Hrsg. von Knoll, Renate. Stuttgart: J. B. Metzler, S. 249f.
Wedgwood, Nikki/Connell, RW: Männlichkeitsforschung: Männer und Männlichkeiten im internationalen Forschungskontext. In: Becker, Ruth/Kortendiek, Beate (Hrsg.) unter Mitarbeit von Budrich, Barbara/Lenz, Ilse/Metz-Göckel, Sigrid/Müller, Ursula/Schäfer, Sabine: Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie. 3. erweiterte und durchgesehene Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft, S. 116-125.
Für die in den 1990er Jahren aus den Gay- und Lesbian Studies entstandene(n) Queer Theory bzw. Queer Studies stellte die Hinwendung zum Poststrukturalismus und damit die Infragestellung einer geschlechtlichen Essentialisierung eine grundlegende Voraussetzung dar (vgl. auch Breger 2002: 327). Zunächst als Schimpfwort für Homosexuelle verwendet, übernahm die schwul-lesbische Emanzipationsbewegung den Begriff 'Queer' in den 1980er Jahren als „Grundlage von theoretischen Einsprüchen gegen die Heterosexualitäts- und Normalitätsanforderungen von Gesellschaft und Wissenschaft.“ (Rendtorff 2011: 229)
Standen zunächst Fragen der Sexualität und des sexuellen Begehrens im Vordergrund der Auseinandersetzungen, so verlagerte sich der Fokus im Zeitverlauf auf eine grundsätzliche Hinterfragung von heteronormativen Identitätskonzepten (vgl. ebd.). Geschlecht und Begehren werden dabei als historisch kontingent sowie als performativ hervorgebracht verstanden. Mit diesem identitätskritischen Gestus richtet sich die Queer Theory gegen die „heterosexuelle Matrix“ (Butler 1991) und eine Naturalisierung der zweigeschlechtlichen Ordnung sowie entsprechende gesellschaftliche Normierungsprozesse, die auf die Theoriebildung von Gay- und Lesbian Studies noch starken Einfluss hatten. Vor allem der kritischen Auseinandersetzung mit Begehrensrelationen und der gesellschaftlichen Normierung von Heterosexualität kommt dabei ein wichtiger Stellenwert zu. Dabei geht es nicht allein um eine Überwindung der lange Zeit bestehenden Trennung von Lesben- und Schwulenbewegung, sondern vor allem auch um die Berücksichtigung weiterer geschlechtlich wie sexuell marginalisierter Gruppen (vgl. auch Breger 2002: 327). Gegenüber der Queer Theory wird ähnlich den Women`s Studies oftmals u. a. der Vorwurf laut, andere Herrschaftskategorien zugunsten des Fokus auf Begehrensrelationen zu vernachlässigen.
(Weiterführende) Literatur:
Butler, Judith (1991): Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Breger, Claudia (2002): Queer Studies/Queer Theory. In: Metzler Lexikon Gender Studies / Geschlechterforschung. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Hrsg. von Knoll, Renate. Stuttgart: J. B. Metzler, S. 327-329.
Degele, Nina: (2008): Gender / Queer Studies. Eine Einführung. München: UTB.
Jagose, Annamarie (2001): Queer Theory: Eine Einführung. Berlin: Querverlag.
Laufenberg, Mike (2019): Queer Theory: identitäts- und machtkritische Perspektiven auf Sexualität und Geschlecht. In: Kortendieck, Beate; Riegraf, Birgit; Sabisch, Katja (Hrsg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung. Wiesbaden: Springer.
Rendtorff, Barbara (2011): Stichworte und Begriffe aus der Geschlechterforschung. In: Rendtorff, Barbara/Mahs, Claudia/Wecker, Verena (Hrsg.): Geschlechterforschung. Theorien, Thesen, Themen zur Einführung. Stuttgart: Kohlhammer, S. 220-233, hier S. 229.
Als transgender wird eine Person bezeichnet, bei der Geschlechtsidentität und äußere Erscheinung bzw. das bei Geburt zugeschriebene Geschlecht nicht übereinstimmen (vgl. Funk 2002: 391), d. h. eine Identifizierung mit einem anderen Geschlecht vorliegt. Dabei wird häufig durch Operationen oder Hormoneinnahme eine körperliche und/oder – etwa durch Namensänderung oder Kleidung – soziale Angleichung an die gefühlte Geschlechtsidentität angestrebt. Bei dem Begriff handelt sich um eine Weiterentwicklung bzw. Nachfolge des Terminus ‚Transsexualität‘, welcher – der sexologischen Typologie aus dem 19. Jahrhundert entstammend (vgl. ebd.) – eine medizinisch-pathologische Konnotation aufweist und diese damit als ‚krankhaft‘ ausweist. Während mit dem Begriff Transsexualität vor allem das biologische und körperliche Geschlecht und damit die sex-category fokussiert wird, steht bei transgender eher das Überschreiten „soziokultureller Geschlechternormen und die Gewaltförmigkeit heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit“ (Hoenes/Schirmer 2019: 1204-1205) im Fokus. Der Terminus Trans* - welcher insbesondere seit 2010 vermehrt genutzt wird – versucht das Spektrum abseits der Zweigeschlechtlichkeut zu erweitern und umfasst auch andere Formen des Transseins wie genderfluid, non-binary, neutrios oder agender (ebd.: 1205).
Die sich in dem Begriff Transsexualität ausdrückende Pathologisierung von Menschen, deren Geschlechtsidentität vom ihnen zugeschriebenen biologischen Geschlecht abweicht, zeigt, wie wirkmächtig die „heterosexuelle Matrix” (Butler 1991) und damit der Zwang ist, sich eindeutig als Frau oder Mann auszuweisen. Dies zeigt auch das bis heute geltende Transsexuellengesetz (TSG), welches über die Jahre immer wieder reformiert wurde (vgl. Valentiner 2022). Politisch wird über weitere Reformen diskutiert, etwa über die Neuregelung der Änderung des Geschlechtseintrags (Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz/Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat 2019) und weitere juristische Reformbedarfe (vgl. Maurer 2021).
(Weiterführende) Literatur:
Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (2019): Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Änderung des Geschlechtseintrags. Online unter: https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Aenderung_Geschlechtseintrag.html (Zugriff: 26.07.2022)
Butler, Judith (1991): Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Funk, Julika (2002): Transgender people. In: Metzler Lexikon Gender Studies / Geschlechterforschung. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Hrsg. von Knoll, Renate. Stuttgart: J. B. Metzler, S. 391.
Hoenes, Josch/Schirmer, Utan (2019): Transgender/Transsexualität: Forschungsperspektiven und Herausforderungen. In: Kortendieck, Beate; Riegraf, Birgit; Sabisch, Katja (Hrsg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung. Wiesbaden: Springer. S. 1203-1212.
Mader, Esto et al. (Hrsg.) (2021): Trans* und Inter* Studies. Aktuelle Forschungsbeiträge aus dem deutschsprachigen Raum. Münster: Westfälisches Dampfboot.
Maurer, Melina (2021): Die Behandlung trans- und intergeschlechtlicher Personen im deutschen Recht de lege lata und de lege ferenda – Ein Überblick über ausgewählte Themen. In: Januszkiewicz, Magdalena et al. (Hg.) Geschlechterfragen im Recht. Berlin, Heidelberg: Springer. S. 151-176.
Rinnert, Andrea (2002): Transsexualität/Transvestismus. In: Metzler Lexikon Gender Studies / Geschlechterforschung. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Hrsg. von Knoll, Renate. Stuttgart: J. B. Metzler, S. 391f.
Valentiner, Dana-Sophia (2022): Geschlechtsidentität und Verfassungsrecht. Das Grundrecht auf Finden und Anerkennung der geschlechtlichen Identität, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur „Dritten Option“ und ihre Folgefragen. In: Januszkiewicz, Magdalena et al. (Hg.) Geschlechterfragen im Recht. Berlin, Heidelberg: Springer. S. 129-150.
Das Konzept des Undoing Gender wurde 1994 von Stefan Hirschauer als Gegenbegriff zum von Candace West und Don H. Zimmermann geprägten Konzept des Doing Gender entwickelt. Hirschauer sieht in der dauerhaften Relevanzsetzung von Geschlecht ein methodologisches Problem und stellt die These auf, dass diese je nach Kontext variiert (vgl. auch Geimer 2013: Absatz 1), bspw. indem sich andere Struktur- oder Differenzkategorien wie race, class oder desire als wirkmächtiger präsentieren. „Ohne eine solche Aktualisierung der Geschlechterdifferenz, die aus Gelegenheiten situative Wirklichkeiten macht, ereignet sich eher ein praktiziertes 'Absehen' von ihr, eine Art soziales Vergessen, durch die sich die Charakterisierung von Geschlecht als 'seen but unnoticed feature' von Situationen verschiebt: nicht von etwas Notiz zu nehmen, ist selbst eine konstruktive Leistung. Ich schlage vor, sie 'undoing gender' zu nennen.“ (Hirschauer 1994: 678, Hervorh. i. O.)
Die von Garfinkel (1967) formulierte Omnirelevanz-Annahme von Geschlecht stellt er daher infrage (vgl. Hirschauer 1994: 676f.). Zwar konstatiert auch Hirschauer (2001: 215) einen fortlaufenden „Ausweiszwang“ von Geschlecht, er beschreibt aber auch Situationen, in denen Personen sich zwar als Frauen oder Männer identifizieren, sich aber nicht als solche adressieren und demnach Geschlecht nicht relevant setzen. Dennoch beschreibt er die „Geschlechtsneutralität“ als eine „äußerst anspruchsvolle und prekäre soziale Konstruktion [...].“ (Hirschauer 1994: 679)
(Weiterführende) Literatur:
Butler, Judith (2004): Undoing Gender. New York: Routledge.
Garfinkel, Harold (1967): Studies in Ethnomethodology. Cambridge: Polity Press.
Geimer, Alexander (2013): Undoing Gender. In: Gender Glossar/Gender Glossary. Verfügbar:
Gildemeister, Regine (2019): Doing Gender: eine mikrotheoretische Annäherung an die Kategorie Geschlecht. In: Kortendieck, Beate; Riegraf, Birgit; Sabisch, Katja (Hrsg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung. Wiesbaden: Springer. S. 409-417.
Hirschauer, Stefan (1994): Die soziale Fortpflanzung der Zweigeschlechtlichkeit. In: Kölner Zeitschrift für Sozialpsychologie, Jg. 46, S. 668-691.
Hirschauer, Stefan (2001): Das Vergessen des Geschlechts: Zur Praxeologie einer Kategorie sozialer Ordnung. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (Sonderheft 41), S. 208-235.
Dr. Annika Hegemann
Gleichstellung
Pohlweg 55
33098 Paderborn
Dr. Claudia Mahs
Zentrum für Geschlechterstudien / Gender Studies
Warburger Str. 100
33098 Paderborn
Sprechstunden
Sprechstunden: Studierende der UPB buchen bitte einen Termin über den Komo Kurs: KW.23.057 Sprechstunde Dr. Claudia Mahs
(Interessierte am Masterstudiengang Geschlechterstudien und an der Anerkennungssprechstunde für den Masterstudiengang Geschlechterstudien sowie für Beratungen zum Mutterschutz schreiben mir bitte einfach eine Mail.)
Roxana Carls
Frauen gestalten die Informationsgesellschaft
Pohlweg 47-49
33098 Paderborn
So finden Sie den Raum P1.6.09.1
Navigation öffnen: